Siebter Abschnitt: Butzenscheibenromantik und Neues Reich
Je moderner im Sinne des 19. Jahrhunderts die Zeitumstände sich darbieten, desto deutlicher nimmt der Wunsch des lesenden Publikums zu, Geschichten aus alter Zeit geboten zu bekommen, und wer unter den Literaten geschickt und selber willens ist, sich mit dem Mittelalter zu befassen, hat Hochkonjunktur und nützt sie weidlich aus. Dies geht einher mit einem Anschwellen der Produktion von Historiengemälden, mehr oder weniger detailgetreu in der Abbildung mittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Straßenbilder, in Nürnberg vor allem vertreten von den Brüdern Paul und Lorenz Ritter, die noch bei Heideloff gelernt hatten, exakte Abzeichnungen von Architekturdetails anzufertigen, und damit für viele Kollegen, auch historistische Architekten, die Muster lieferten.1 In dieser künstlerischen Umgebung nimmt sich auch der Blumenorden, zum Teil durch Produktion von Mitgliedern, zum Teil durch Heranziehen von Publikumslieblingen zu Ehrenmitgliedern, dieser Traumwelt an. Daneben halten sich Beispiele klassizistischer Literaturauffassung, treten neuartige Proben exotischer Themen aus dem Schatten. Alles dieses wird freilich durch die kriegerischen Verwicklungen von 1864 bis 1871 überlagert, die sich ebenso ins mittelalterliche Gewand einkleiden wie realistisch darstellen oder mit aktuell politischer Stellungnahme aufladen lassen. Zunehmend wird man gewahr, daß in der Verarbeitung der Themenvorgaben sowohl verklärend als auch anklagend verfahren wird: Unterscheidungen zwischen affirmativen und pessimistischen Dichtern fangen an, in den Debatten der Ordensversammlungen eine Rolle zu spielen. Vorläufig aber eint die Parteien noch die Begeisterung über den kaum für möglich gehaltenen militärischen Erfolg und die Reichsgründung — beinahe.
Herr Heinrich saß am Vogelherd
Otto Roquette war ein beliebter Verfasser butzenscheibenromantischer Erzählungen. Kein Passenderer als der am 12. 8. 1844 in den Blumenorden aufgenommene königlich bayerische Forstmeister Karl Friedrich Seippel konnte über Roquettes „Waldmeisters Brautfahrt“ einen Aufsatz liefern. (Seippels eigener Beitrag war „Die wilde Jagd. Wahrheit und Dichtung“ von 1851.) Und von Franz Schrodt gibt es einen „Vortrag über Herr Heinrich Eine teutsche Sage von Otto Roquette gehalten in der öffentlichen Versammlung des pegnesischen Blumenordens zu Nürnberg am 13t Maerz 1854. im Saale des Gasthauses zum rothen Roß.“: „Otto Roquette der bekannte Dichter des anmuthigen Märchen, Des Waldmeisters Brautfahrt und des geschichtlichen Heldengedichts ,Der Tag von Sct. Jacob’ hat uns in der vorliegenden Sage ,Herr Heinrich’ auf deutschen Boden und in die Zeit geführt, zu welcher Deutschland durch äußere und innere Feinde dem Verfalle nahe gebracht, unter dem kräftigen Könige Heinrich I mit dem Beinamen der Finkler wieder zu erstarken, sich zu consolidiren und die ihm nöthige Einheit zu gewinnen begann […]“ Das bedeutet: Der frustrierte Nationalstolz orientierte sich am Alten Reich.
Demgegenüber erscheint es schwer verständlich, mit welcher Begründung (auch wenn es einfach nur an Geld mangelte) der Vorstand die Beteiligung an einem öffentlichen Zeichen des Gedenkens an einen Dichter ablehnte, der gerade solchen Nachromantikern wie Roquette in Berlin lange Zeit als Denkmal seiner selbst und der Jenenser Frühromantik vorbildhaft vor Augen gestanden hatte: „Ein per Majora angenommener Antrag, zu dem für den verstorbenen Dichter Tieck aufzustellenden Denkmale, etwas aus der Ordenskasse beyzutragen, wurde in Folge einer Vermahnung von Seiten des Ordensvorstandes u. vorzüglich des Kassiers gegen eine solche fremdartige und dem Ordenszweck nicht entsprechende Ausgabe wiederum zurückgenommen.“ Waren die eigentlichen Romantiker nicht nationalistisch genug?
Greger sen., der Volksbeglücker, kleidete seine sehr prosaischen Vorschläge zur erneuten Errichtung von Armenkolonien — der erste Versuch dieser Art war schon bei Ingolstadt unternommen worden — in mittelalterliche Romanzenform, genauer gesagt, er parodierte Goethes Ballade „Der Sänger“: „König Max II. zum Landtage 1853. Eine Vision-Romanze.“:
I.
„Was hör’ Ich draussen vor der Thür’
Für süsse Töne hallen?
O rührender Gesang, der Mir
Im Saale soll erschallen!“
Der König sprach’s. Der Page lief.
Der Sänger kam. Der König rief:
„Sing’ uns hier Deine Lieder!“
[…]
IV.
[…] Nun wirken Kräfte aller Art
Für Armenhilf’ zusammen.
In gift’ges Moos, auf Heiden ward
Gestreut der beste Samen.
Und Früchte wuchsen reich heran.
Auf Felsen man selbst erndten kann,
Wenn man sie terrassiret.
Ein jeder Armer wird genährt,
Bekömmt nun Kleid und Wohnung;
Das Eigenthum bleibt unversehrt;
Der Fleiss erhält Belohnung.
Man kann des Lebens sich erfreu’n;
Die Menschen können ruhig sein
Vor Diebstahl, Neid und Hunger.
Die schönsten Häuser sieht man da
Zu Aller Nuzen prunken;
Der Sumpf wird ein Amerika
Vor Blühenreichthum trunken; —
Ein jegliches Gewerb erblüht;
Denn Müssiggang und Laster flieht
In rechtlichem Vereine. […]
Vor dem Hintergrund solcher Kostümierungen hebt sich der nüchterne Sondermann ab, selbst wenn er im Januar 1851 die Jungfrau von Orleans zum Thema wählt: In bewährter Weise gibt er eine historische Übersicht und übersetzt dann ein Gedicht von Casimir Delavigne mit möglichster metrischer Treue. Als Literaturhistoriker im eigentlichen Sinne erweist er sich, als er sich mit Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht über das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard auseinandersetzt. Am 16. Dezember 1853 beginnt er damit in einer der Wochenversammlungen und vertieft die Betrachtung am 9. Januar 1854, wobei er freilich erst einmal historische Hintergründe und geographische Angaben breit abhandelt, dann aber auf eine zeitgemäße Fragestellung eingeht:
„Auf dem Gebiete der Literatur glänzen in neuester Zeit auch die Namen vieler Frauen. [Er führt u.a. folgende Namen auf:] Bettina v. Arnim, Annette von Droste-Hülshof [sic], Ida v. Hahn-Hahn, Fanny Lewald, Sophie Stieglitz, Caroline Pückler, Johanna Schopenhauer, […], Fanny Tarnow, Luise v. Gall, Hermine von Chezy, Adelheid v. Stolterfoth, […] Daß das Weib ebenso wie der Mann zur Poesie angelegt sey, kann wohl nicht bezweifelt werden, da die Poesie ein allgemein menschliches Erbtheil ist. Auch das ist keine Frage, daß auch Frauen als Schriftstellerin an die Öffentlichkeit treten und die poetische Welt ihres Innern zur allgemeinen Anschauung bringen dürfen. Nur darf man mit Recht erwarten, daß das Weib als Schriftstellerin eben weiblich bleiben u. die Schranken, welches seinem Geschlechte von Natur u. Sitte gezogen sind, nicht überschreite.“
Nun teilt er die Genannten in zwei Gruppen ein, von denen die erste dagegen verstößt, etwa Bettina v. Arnim, die Rachel, die Gräfin Hahn-Hahn, und zitiert Urteile von Literaturhistorikern, welche Annette v. Droste-Hülshoff am höchsten von allen weiblichen Schriftstellern schätzen. „Solch gewichtige und ehrende Urtheile fordern zum Lesen der gepriesenen Gedichte und zur Prüfung der gefällten Urtheile auf. Gerechtfertigt wird es daher auch erscheinen, wenn ich im Nachfolgenden die poetischen Erzeugnisse der Dichterin zum Inhalte eine Vortrages vor dieser […] Versammlung wähle.“ Es folgt eine lange Biographie, dann Nacherzählungen und Beschreibungen unterschiedlicher Gedichte mehrerer Gattungen. Dort findet sich das Urteil: „Dabei aber zeigt sie eine Objectivität der Auffassung, eine Kraft und Keckheit des Ausdruckes und ein dramatisches Leben, daß man sich oft wundern muß, wie das einem weiblichen Talente möglich war.“
Schnerr verwendet den Anlaß des Irrhainliedes von 1854, um eine politische Wunschvorstellung in sagenartiger Form auszusprechen, die in der jetzigen Zeit des Islamismus und der Angst vor diesem einigermaßen kurios anmutet:
Ja wohl: „Glück auf!“ Glück braucht’s in unsern Zeiten,
Wo nichts idyllisch mehr,
Wo Völkermassen ernst und bitter streiten,
Gewaltig, Heer um Heer.
Zwar nicht bei uns; im Osten steht das Wetter,
Das ganz Europa droht,
Ist nicht der Herr der Heere unser Retter,
Lenkt’s nicht sein Machtgebot. —
Die Sage geht! „Es wird’ nicht eher Friede
Auf unserm Erdtheil sein,
Als bis der Türk’, sein Schlachtroß, matt und müde,
Tränkt dort zu Köln am Rhein.“
Wär’s so bestimmt, so mög’s „als Freund,“ sich fügen;
der Sultan ist ja nicht
So orthodox, um andre zu bekriegen,
Aus inn’rer Herrscherpflicht.
Was auch gescheh’. Es steht in Gottes Händen,
Sein Wille muß gescheh’n.
Er wird das Uebel selbst zum Besten lenken,
Zu aller Wohlergeh’n.
Daß es Schnerr so gänzlich unideologisch und realpolitisch egal ist, wer ihn regiert, Hauptsache, das Land hat Frieden, kommt noch von der Gewöhnung an die Zerrissenheit des Alten Reiches. Im Jahr darauf lassen sich andere Ordensmitglieder allerdings sehr loyal zum neuerdings angestammten Herrscherhaus vernehmen:
Sein Daseyn dankt’ der Blumenorden
Einst einem Blumenkranz.
Die Blumen, niemals welk geworden,
Blüh’n noch im vollen Glanz.
Er reicht dem Könige sogar
Den immer frischen Kranz jetzt dar.
Gewunden, ohne Dornen, aus Rosen,
Mit welchen bescheid’ne Vergißmeinnicht kosen,
Von üppichen Immergrün kräftig getragen,
Versucht er, — dem Thron sich zu nahen, — das Wagen.
Erhab’ner König, unter deßen Pflege
Die Kunst, — die Wissenschaft gedeiht,
Es blühe reich auf Deinen Wege
Die Blume der Zufriedenheit!
Erworb’ner Lorbeer-Kranz soll Deine Schläfe schmücken
Und Deine Huld und Gnade uns beglücken.
Ein Myrthen-Kranz gebührt der holden Königin!
Wohl nimmt sie gnädig ihn aus treuen Händen hin!
Es ist das Sinnbild ew’ger Jugend,
der Liebe, Treue, und der Tugend.
Er bleibe grün, wann einst ein Silberstreifen ihn durchzieht,
Er grüne noch, wann Gold auf seinem Grunde glüht!
Die schönsten Blumen sind in unseren Kranz gewunden.
Es sind noch nie erlebte Feierstunden.
Sie sind, — in später Zeit, den Enkeln noch genannt,—
Mit Farben-Schmelz den Herzen eingebrannt.
v.Kreß
Seiler will auch nicht zurückstehen:
Wenn sonst im Schatten dieses Haines
Die Lust und Freude uns durchdrang;
Wenn der Pokal, voll reinen Weines,
Umkreisete im Festgesang:
Da war so wohl uns um das Herz;
Da floh die Sorge, schwieg der Schmerz.
So soll’s in diesen Abendstunden,
Ihr, Pegnitzschäfer! wieder seyn.
Wir haben uns hier eingefunden
Mit Frauen, Liedern und mit Wein.
Und wer nicht liebet diese Drei,
Verdient nicht, daß er bei uns sey.
Doch über Frauen, Lieder, Weine
Geht das erhab’ne Königspaar,
Das im Pegnesischen Vereine
Sich jetzt stellt unsern Blicken dar.
Zu Ihm fühlt sich gezogen hin
der Geist, das Herz im reinsten Sinn.
Denn bei dem Namen: „Max,“ entbrennet
Der Bayern treuerfüllte Brust,
Wie wenn der Sohn den Vater nennet,
Durchdrungen ganz von Kindeslust:
So stimmen froh das Lied wir an
Auf König: „Maximilian!“
Und auch auf die Gebenedeite,
Auf uns’re Königin: „Marie!“
Sie, unser Stolz und uns’re Freude
Und uns’re Landesmutter — Sie,
Ihr weihen wir des Festes Lied,
Ihr, die holdselig auf uns sieht.
Ja, hört es, Zweige! Hört es, Bäume!
Wem unser Festlied heute gilt.
Ihr, Geister! die ihr diese Räume
Mit leisem Wehen jetzt erfüllt —
Hört es und stimmt das Lied mit an
Auf Marie und Maxmilian! [sic]
Viel Zeit zum Feilen seiner Verse hat er vorher nicht gehabt. Nachhaltiger ist schon, daß die erste geplante Vorstadt Nürnbergs Marienvorstadt heißt, daß es ein Marientor und eine Marienstraße gibt. In einem anderen Teil des Geländes vor den Mauern, das seit damals Maxfeld heißt, fand ein „Königsfest“ statt, zu dem der später in den Orden aufgenommene Johann Paul Priem einen Einakter lieferte: „Die Zeitalter Nürnbergs“:
Ein Dichter sieht den Glanz der alten Tage in dem Festgepränge zur Anwesenheit des Königs wieder aufleben. Clio kündigt eine Überschau der alten Zeiten an, welche nur die Kunst festhalten könne. Der Jägermeister preist den Hohenzollern-Burggrafen, weil er manche Räuberburg gebrochen hat und der Bevölkerung Schutz bietet. Der Künstler lobt die Friedenszeit und nennt die üblichen berühmten Namen der Dürerepoche. Der Kaufherr hebt den weiträumigen und erfolgreichen Warenaustausch hervor (ein wenig unpassend, wenn er dem 17. Jahrhundert zugeordnet wird, aber das geht aus dem Text nicht hervor, nur aus dem Personenverzeichnis). Der Handwerksmeister drängt aus der Menge hervor und spricht Mundart. Er erinnert an die wirtschaftliche Flaute und die französische Besetzung und freut sich über die geordneten Verhältnisse der Stadt unter Bayern. Nur das Bier sei jetzt doppelt so teuer. Seine Frau kommt dazu und zankt ihn aus, weil ihm das Dichten nicht zukomme. Clio stiftet Frieden zwischen den Eheleuten und weist auf den Aufschwung der neuen Friedenszeit hin. Ausführliches Herrscherlob beendet den Aufzug.
Eine sehr durchsichtige Verquickung von literaturhistorischer Altertumsforschung und antidemokratischer sowie nationalistischer Einstellung zeigt sich in der Ausarbeitung über eine mündlich weitererzählte Fassung der Nibelungensage, aufgezeichnet und kommentiert von Ferdinand Hermann Freiherr von Forster, Mannheim im November 1855:
Meine Zusage, die die Herren so gütig aufgenommen haben, bindet mich auch von hier aus dem Blumenorden Zeugniß abzulegen, welch’ hohen Werth ich auf seine altehrwürdige Gründung, welche dankbare Anerkennung ich auf meine Aufnahme in denselben lege.
[…] Aber meine Geistesprodukte berühren, wie bekannt, nur historische Momente, und was hat Mannheim, die moderne Stadt, für eine Geschichte? Eine geheime Geschichte mag wohl zur Zeit, als die Jesuiten hier einheimisch waren, gespielt haben; aber weil sie geheim war, ist sie mir nicht bekannt; außer diesen, hinter dem Vorhang heiliger Andacht gespielten Stücken Welt oder Particular-Geschichte ist nur etwa die Zeit neuester Auflehnung gegen die bestehende Gewalt, die zweimal in Mannheim eine blutige Ausführung fand, zu erwähnen. Das erstemal, als in Folge der Studentenverbindung auf der Wartburg der verkehrte Muth eines Sand im Jahre 1819 in Meuchelmord ausartete, und mit Recht an dem Leben gestraft wurde: das andere Mal — nun, das haben wir Alle kürzlich mit angesehen, als im Jahre 1849 die frevelnde Auflehnung gegen die öffentliche Gewalt, gegen Regenten und Regierung, mit Waffengewalt bezwungen werden mußte […] da findet sich der Richtplatz und das Grab von fünf Verbrechern, die der von Gott eingesetzten Obrigkeit Hohn sprachen!
[…] Nur eine Sage aus grauer Vorzeit bleibt uns in hiesiger Gegend noch zu erwähnen übrig […wovon] nur durch Aufzeichnung derselben in einem nordischen Gedicht, die Kenntniß davon zu uns gekommen ist — doch nein, im Umgang mit dem Volke aus der Gegend zwischen dem Rhein und der Bergstraße lebt sie noch, wenn gleich entstellt, und in dem Munde alter Mährchenerzähler dargestellt: ich meine die Sage vom Nibelungen-Schatze oder Horte! […] Mag auch die Zeit, in welcher der Dichter lebte acht Jahrhunderte später die Begebenheiten beschreiben, obschon die Poesie manche Wahrheit entstellt, manches Mährchen hinzugefügt hat, so ist das Bild der Völkerwanderung und zwar in der Gegend des heutigen Mannheim, lebendig vor unserem historischen Auge entrollt.
[…] dann aber zeigt uns das gegebene Bild auch Rohheit — der rauhen unbeugsamen Tugend steht das Laster mangelnder Herzens- und Geistesbildung entgegen — der Treue steht die Racheübung, der Züchtigkeit der Sitte steht die Gemeinheit des Ausdrucks, der ungezügelten Tapferkeit steht die Mordlust entgegen: […]
Die einfache Sage, freilich in der [sic] fabelhaften Gewand, ist im Gedächtniß der untersten Volksschicht der hiesigen Gegend ungefähr so:
„Ein mächtiger König hausete in Worms und warb für seinen Sohn um eine Königstochter aus England: aber immer vergebens; da kam ein anderer Königssohn aus den Niederlanden — Siegfried — bekleidet mit dem Zauber der Unüberwindlichkeit, und mit den bösen Mächten im Bund, und warb um dieses Königs Tochter — Chriemhilde — die ihm unter der Bedingung zugesagt wurde, wenn er seinem künftigen Schwager zum Besitz seiner Wünsche in England verhelfen wolle. Vermittelst übernatürlicher Kräfte erfüllte er seine Aufgabe, bezwang die, ebenfalls mit Zauberkräften ausgestattete Braut und gab sie dem (heimischen) Königssohn, erhielt auch dagegen die Hand der schönen Chriemhilde und brachte ihr einen unermeßlichen Schatz zu, der ihm unter der Bedingung zugefallen war, daß ihm eine jungfräuliche Königstochter Hand und Herz zu eigen geben würde. Aber die bösen Geister, wo sie einmal Fuß gefaßt, rasten nicht, sondern wenden alles zum Argen. Die Frauen seien wegen Liebesabenteuer eben so, wie die Männer wegen des Hortes — Schatzes — in Feindschaft gerathen, und unter dem Vorwand der Jagd, sei Siegfried in des [sic] finstern Dunkel des Waldes getödet, und im Odenwald, nur wenige Stunden von der Stadt Weinheim an einer Quelle nahe dem Dorfe Gras-Ellenbach von des Königs Knechten erschlagen worden: große Feldsteine an der Quelle bezeichnen noch heute den Ort der That. Ueber den Schatz sei nun erst recht Streit und Kampf entbrannt, und obgleich die Mörder Siegfrieds diese Beute nahe dem Kloster Lorch in den Rhein versenkt hätten, wo sie noch heute liege, so habe man doch damals Zweifel darüber gehabt, und namentlich habe die Wittwe des Erschlagenen, die schöne Chriemhilde darauf Anspruch gemacht. Ihren Vater, ihren Bruder und die wehrhaften Männer des Stammes habe sie angeregt die Mörder zu züchtigen, und von ihnen den Schatz zu erzwingen; und als Alles vergeblich gewesen, habe sie sich an den König eines fremden Volkes in Italien aufs Neue vermählt, um von dorther über die Ihrigen, über den Stamm ihrer Herkunft Rache zu bringen, denn sie hielt sie nun Alle für schuldig, den Schatz geraubt und ihr vorenthalten zu haben. Aber sie habe vergebens gefleht die Ihrigen mit Fehde zu überziehen — ostwärts war kein Volk in jener Zeit zu gehen vermocht worden! — da blieb ihre einzige Hoffnung darauf gerichtet, die Ihrigen zu sich einzuladen; Gesandte ihres Gemahls und Königs kamen nach Worms den angebornen Stamm samt König und Mannen zu sich zu laden; Spiele ritterlicher Art, Kämpfe mit hohen Gewinsten und Lustbarkeiten wurden verheißen, und unter den lachendsten Aussichten bricht der königliche Bruder, seine Ritter und Mannen und die kriegerischen Stammesgenossen auf, das ferne Hoflager zu besuchen. Doch kaum dort angekommen, werden die Verwandten um den Schatz gefragt, und dessen Herausgabe begehrt; und als sie denselben nicht herausgeben wollen oder können, entsteht ein fürchterliches Morden und Schlachten der heimischen Stammesgenossen; doch diese verkaufen ihr Leben so theuer, daß nicht allein jenes Volk gänzlich aufgerieben, sondern auch des Schatzes für alle Zeiten verlustig wird, indem der letzte aus der heimischen Burgunder Reihe die Hebung dieses Hortes von argen Zauberkünsten abhängig macht, und ihn zum ewigen Begräbniß verurtheilt, wenn nicht übernatürliche Kräfte zu Hülfe kommen, ihn zu heben.“
[…] wir aber finden in der Betrachtung der Sage […] die unwiderstehliche Richtung der Völker nach Westen — die Wanderung germanischer Völker nach dem unheilbringenden Italien, das unsere Völker fort und fort aufgerieben und selbst ihre Namen und Abstammung, Schätze und Güter verschlungen hat. […]
Eine bei weitem harmlosere Betrachtung mittelalterlicher Überreste liefert der redliche Sondermann, diesmal als Sonett-Dichter, zum Irrhainfest 1856:
Von grünem Schmucke bist du rings umgeben,
Am Pegnitzstrande schatten alte Linden,
Selbst an der Mauer seh’ ich Epheu winden
Sich zu dem schönsten Wändeteppich weben.
Die Gräben, Thore, spitzer Giebel Streben,
Der Häuser Form, der alten Bauten Tinten,
Die Märkte, Brunnen, Bilder, Erker künden
Noch überall des Mittelalters Leben,
So daß ich deine Meistersänger, deine
Rathsherren, hier in schmaler Gäßchen Enge,
Dort auf dem weiten Platz, zu sehn vermeine.
Wie tief bewegen mich der Glocken Klänge,
Der Gottesacker schwere Leichensteine
Mit ihrem Epitaphiengepränge!
Exotisches Intermezzo
Ferdinand Freiligrath hatte mit Versen Aufsehen erregt, die er selber als „Wüsten- und Löwenpoesie“ bezeichnete. Ähnliches haben wir auch von Friedrich Knapp, nur daß dieser die fernen Schauplätze selbst gesehen hatte und selbst Erlebtes beschreibt. Er war am 18. 6. 1828 auf der Festung Rothenberg bei Schnaittach als Sohn des Kommandanten geboren worden und wandte sich früh als Handeltreibender ins Westindische und nach Mexiko, kehrte 1856 zurück und trat alsbald dem Literarischen Verein bei. Aus dieser Zeit stammt wohl der gedruckte, aber undatierte Text „Eine westindische Nacht. Tagebuchskizze von Friedrich Knapp.“
I.
Oh, jung zu sein, gesund, sorglos, heiteren Gemüths und seit geraumer Zeit eingewöhnt in Sitten, Sprache und Klima der wogenumbrandeten Habana, der brausenden und strahlenden Metropole der großen Antille Cuba! […]
Im Süden des Bollwerks der Puerta de la Terra, welches mit seinen Halbmonden, Cavaliren, Ravelins und Zugbrücken jetzt auch schon wieder seit Jahren dem Einebnungseifer des Jahrhunderts weichen mußte, breitet sich der kleine Montserrateplatz aus, in welchen verschiedene Hauptstraßen geradlinig aus dem Innern der Hauptstadt münden, eingefaßt von einstöckigen, blaugetünchten Häusern mit platten Dächern, Holzaltanen und vergitterten thürhohen Fenstern, gegen die Straßen wunderliche Bazare bildend für alles mögliche Käufliche vom Geringsten bis zum Feinsten. Dorthin schlenderte ich nach Contorschluß mit einigen Freunden, um die herrliche Nachtbrise auf dem vor den Thoren beginnenden Prado, einer sechsreihigen Palmen-, Platanen- und Ahornallee, bis zur Ostspitze der Küste hinziehend, zu genießen. […]
Durch 2 niedere, verhältnißmäßig tiefe, mit starken Wachen besetzte Thore für strengbeaufsichtigte Aus- und Einfahrt, ziehen Volanten, Quitrine, Caretten, Carretones, Omnibusse und die damals neu eingeführten Doktorwagen unterbrochen von bunter, in jeder Beziehung colorirter Menge unaufhörlich aus und ein. Nach der Bischof- und Oreylli-Straße eilen nun, denn rasch dunkelt die westindische Nacht heran, der Lampenanzünder leichtfüßige Schaaren, auf daß reichliches Gaslicht (blendender und ausgiebiger als in unserem [sic] norischen Metropole) seinen wohlthätigen Schimmer in die eigenthümlichen Straßenschluchten gieße. […] vor der Hauptwache gruppiren sich weißröckige Füsilire vom Regiment Catabria um den Curro, den Compagniespaßmacher, der zur Guitarre bei Castagnettenbegleitung andalusische „Schnadahüpfeln“ improvisirt, die an Witz und Schlagfertigkeit ihren altbayrischen Schwestern nichts nachgeben. […] Hier vor der Schmiede, dort vor der Posada zum hölzernen Herz und einem Miethstall (del Pegaso lautet die stolze Firma!) lassen sich jetzt platanosbratende, Naschwerk verkaufende, Haselnüsse röstende Negerhäuflein um ihre Gluthpfannen nieder, Kunden anlockend und sich selbst mit Singen ergötzend; hie und da klimpert ein Ladenschwengel dreizehnter Ordnung oder ein abgelegter Kleiderhändler Etliches auf schauderhaft gestimmten Seufzerkasten; aus den benachbarten Gaswaarenlagern klingt die originelle Weise der mit Vorliebe dort aufgestellten Schwarzwälder Orgel — kurz an Leben, Tonfülle, Staub, Hitze und animalischen, culinarischen, vegetabilischen, mineralischen und amorphen Gerüchen fehlte es auf der Plazuela de Montserrate weder damals noch nach kürzlich angelangten Briefen auch heute nicht. […]
II.
[…] Dieser in zauberhafter Nacht noch anmuthiger erscheinenden Arkaden und Rundgänge erfreuten wir uns in traulichem Geplauder, ohne uns durch das ferne Getöse einer Diebshatze zu kehren, welch unter wüstem Gejohle mit Schüssen untermischt eine abliegende Vorstadt durchzog. Solchen Diebshatzen (Atajas) weicht man gern aus, da sich an die Fußstapfen des Verfolgten nicht nur Flüche und Verwünschungen, sondern alle möglichen Wurfgeschosse, Steine, Messer, Lassoschlingen und selbst Kugeln heften, abgesehen von dem wenig rücksichtsvollen Entgegenkommen des entgegenkommenden Flüchtlings. Dem Eindruck der ersten selbsterlebten Ataja suchten wir in folgendem Gedicht Ausdruck zu geben:
Ataja.
Schon von ferne durch die Straßen hör’ ich wildes Rufen schallen,
Näher dringt der Menge Wogen, weit voraus den Andern Allen
Springt ein Neger, seinen langen Fingern kam man auf die Spur —
Ein geöffnet’ Thor ihn rettet, aber auf Minuten nur.
Lauert draußen die Verfolgung, harret drinnen der Verräther,
Schon umringt das Haus ein Fluthen und erwartend starrt ein Jeder,
Denn im Hause wird’s lebendig, horch! ein Schrei, der widerklang,
Drinnen wälzt sich’s auf und nieder wie im heißen Kampfesdrang.
Rufen, Stoßen, langes Stöhnen! Sparren brechen, Riegel klingen,
Krachend stürzt der Fensterladen und hinan an’s Gitter schwingen
Sieht man mit gelenken Gliedern, blanker Klinge, Schmerz und Hohn,
Blut am Arm und an den Schläfen trotzig droh’n der Wüste Sohn.
Aehnlich dem Hyänenbrüllen tönts dem Flüchtigen entgegen
Der am Gitter eben kauert und den Steinen trotzt verwegen
Die ihm Brust und Stirne schlagen, einen Vortheil nimmt er wahr
Ein Getös’, — das Gitter splittert und er stürzt sich in die Schaar.
Seine Wucht stößt manchen nieder, ein verzweifelt tolles Wagen
Schirmt ihn und nach kurzem Ringen hat der Dieb sich durchgeschlagen
Eilt nun auf beschwingter Sohle (wie sein Gott) voran dem Troß
Der Tienda zu, wo grasend harrt ein aufgezäumtes Roß.
Und mit einem raschen Satze in den Sattel sich geschwungen
Fliegt er fort gleich einem Pfeile, doch Ataja! ist erklungen
Den Verwegnen aufzuhalten, pflanzt sich wie ein Feuer fort.
Züngelnd gleich der Pulverschlange folgt die That dem wilden Wort.
Stöcke fliegen nach und Steine, aus den Thüren Beil und Sessel,
Töpfe, Pfannen, Hämmer, Messer und des Lasso’s sichre Fessel,
Männer, Frau’n und Kinder, Hunde, — Jedes seine Kraft versucht,
Um dem Schelm, dem braunen Gauner zu verlegen Heil und Flucht.
Am Paseo schreitet schildernd auf und ab die Reiterwache,
Sieht den Dieb herunterjagen, hört den Ruf um Haft und Rache,
Fährt mit kaltem Blut zur Wange mit dem blinkenden Geschoß,
Zielt — und durch die Stirn getroffen stürzt der Neger von dem Roß.
Uber die Bay zogen die rauschenden Accorde der Retraite und bald nahm uns Lustwandler die stattliche Königinstraße auf […] Hier zeigt es sich wieder, wie ein Machtwort eines schöpferischen Mannes, des gewaltigen General Tacon aus einer früheren Wüste das belebteste Stadtviertel Habanas, trefflich bebaute Straßen, hübsche Häuser und ein geregeltes Bauwerk von 3 Märkten, 100 Läden und ebenso vielen Privatwohnungen mit geräumigen Altanen und Asoteen (flachen Dächern) hervorzauberte. […] Müde wandten wir uns zu den Delicias hin, einer der Plaza de Vapor schräg gegenüberliegenden Konditorei, umgeben von in der Nachtbrise säuselnden Alamos, unter deren wogendem Gezweige Marmortischchen, Stühle und ein prächtiges Ananas-Eis dem erschöpften Wanderer Ruhe und Genuß versprachen. Unter ihren vielen Schwestern ist die Confiteria de los Delicias gewiß eine Perle hinsichtlich ihrer Lage, der Güte ihrer Erfrischungen und Stärkungen (worunter solide Beefsteaks, Austern, Weine und starke englische Porter, Ale und Stoutbiere ebensogut wie hunderterlei Süßigkeiten und Kühltränke zählen), sowie freundlicher Bedienung. […] Wir eroberten den ersten besten Tisch […] und betrachteten hinter einem Crystallkrater Erdbeereis, wozu Barquillas (unsere Holippen) köstlich mundeten, das vor uns sich entfaltende Nachtbild. Wir genossen nach Al Hafis Lehre weise und gründlich. Rings um uns wandelten die lieblichen Kinder der Tropen mit ihren Müttern, Ayas und Duenas, promenirten liebenswürdige Ehemänner, gezähmte Haustyrannen, gütige Väter und das galante Jungcuba ab und zu; drüben lag die Plaza, durchkreuzt von Vehikeln jeder Art, vom New-Yorker importirten Omnibus mit roth-gelbem Drehlicht, bis zur spät von der Arbeit kehrenden Carrete. […] Da kommt tänzelnd und psalmodirend Don Juan Pepe Fernandez, unser langjähriger andulischer [sic] Freund mit all’ den Liebenswürdigkeiten und Schwächen seiner Landsleute wohl ausgestattet, auf uns zu und nöthigt nochmals zu einer kleinen pikanten „Vuelta“, dem beliebten Rundgang unter den mit Rejilla, Mantilla und Fächer bewehrten und oft gefährlichen Huldinnen, wo sich öfter wohl leichter etwas „anbandelt“ (wie der Spanier wortgetreu sagt enhebillarse), als dem Betreffenden lieb ist. Nach beendeter Schau trafen wir noch mehrere Jugend- und Berufsgenossen und saßen rauchend, scherzend, plaudernd, Bekannte unter den Wandelsternen grüßend und bewundernd, bei einer nachträglichen Flasche Jeres de la Frontera in wonniger Nacht, bis der schrille Ton der Nachtwächterpfeife, sowie das gedehnte Las diez y media-a-a-a und das in wunderlichen Trillern und Cadenzen correspondirende y sere-e-e-eno! — („halb elf Uhr und heiterer Himmel!“) uns den Schlummer und die Fliegennetze aufsuchen hieß.
Wir wären übel beraten, das Wort „Neger“ hier aus neudeutscher Ziepfigkeit herauszukürzen, ist es doch ganz offensichtlich, daß des Verfassers Sympathien auf dessen Seite sind. Er läßt als echter Kosmopolit die Leute gelten, wie sie sind, erlaubt sich gutmütige Kritik im ursprünglichen Sinne von „Unterscheidung“ an Landsleuten anderer Zonen und ist von der Überheblichkeit späterer deutscher Kolonialherren weit entfernt. Auch das Wort „Zigeuner“ werden wir seiner einfühlsamen Rühmung nicht verbieten: „Die Perle der Puszta.“
Ein span’scher Klipper hatte uns an Bord;
Seetüchtig war er nicht. — Er zog mit Schwanken
Den halben Ocean in seine Planken,
Die Strömung hielt uns fest an einem Ort.
Trotz Allem hoffend der gewährten Frist —
Da Tag um Tag nach Zollen wir bemaßen,
Zu welcher Stund’ uns gier’ge Haye fraßen —
Hat man das letzte Segel aufgehißt.
Das Segel zog. Es gieng zwar schlecht, doch fieng’s —
Nach bitt’rer Nacht (man dachte nicht ans Schlafen)
Lief unser Schiff im halbversteckten Hafen
Lagartos ein und ans Calfatern giengs.
Bald darauf spie die mexikan’sche See
Noch einen zweiten, schlotternden Seekranken
Ein deutsches Barkschiff aus, dem jüngst vom blanken
Verdeck den Mast gefegt die grimme Bö.
Und unterm Schiffsvolk, das zu Werke gieng,
Die tiefen Wunden dürftig auszuflicken,
Sah’n zwei Zigeuner wir zum Spiel beschicken
Ein Geigenpaar, das überm Bündel hieng.
Woher sie kamen? Fragt sie doch, woher
Zigeuner kommen? Daher, dorther eben —
Wie Sporen säet sie aus ein wildes Leben,
Berechnen könnt Ihr sie wies Ungefähr.
Doch galt dies gleich! ihr Spiel fing leise an,
Dann schwoll es mächtig, wogte auf und nieder —
Noch kannt’ ich damals nicht der Puszta Lieder —
Die mir’s seitdem so zaubrisch angethan.
Dem Zimmermann entfiel das fleiß’ge Beil,
Der Tom glitt samt dem Teertopf von der Wandung,
Der Kapitän, der ernst geprüft die Brandung,
Nimmt auf Minuten selbst am Spiele Theil:
Rings drängten wir ums braune Paar uns her,
Die geigend auf der nackten Klippe saßen —
So daß wir Beides um ihr Lied vergaßen,
Das lecke Schiff, das ruhelose Meer.
Auch in literaturgeschichtlicher Hinsicht äußert sich Knapp mit derselben Genauigkeit der Beobachtung und mit ebensolchem Sprachgeschick, und er gibt aufgrund seiner wohlerworbenen, gründlichen Kenntnis des Spanischen seinen Nürnberger Hörern oder Lesern gerne Auskunft über spanische Literatur samt Vergleichen mit der hiesigen. „Die Insel Janja, das andalusische Schlaraffenland.“ ist eine Arbeit auf dem Niveau eines literaturgeschichtlichen Oberseminarreferats: In erschöpfender Weise, mit vielen Literaturangaben, die bis in die hellenistische Zeit zurückreichen, vergleicht der Verfasser die Grundidee einer Insel der Seligen, vor allem in den Ausprägungen des Schlaraffenlandes von Hans Sachs und der 1347. Romanze des Romancero, die er in gereimten Strophen unterschiedlicher Länge vollständig übersetzt.
Sammler und Kritiker
Man hielt nach mehreren Seiten Ausschau. Der eigenen Geschichte widmete Dr. Lochner einen Vortrag über „Nürnberg-Köthener Briefwechsel, oder: Gg. Phil. Harsdörffers Bezüge zur Fruchtbringenden Gesellschaft“ und Dr. Johann Philipp Florentin Göschel über „Ein Gedicht von Grübel in Nürnberger Mundart: auf eine Illumination im Irrhain im Jahre 1791.“ Dr. Lösch stellte am 15. Dezember 1854 den „russischen Dichter, Puschkin“ und am 20. Februar 1857 „Proben aus der Kalevala, einem finnischen Epos“ vor. Angesichts dieser anregenden Vielfalt kommt schon 1857 der Wunsch auf, „daß der Orden doch wieder einen Band seiner geistigen Arbeiten im Druck herausgeben soll und nach längeren Verhandlungen deßhalb vereinigte man sich zuletzt dahin, daß der H. Ord. Vorst. ersucht wurde, die Sache in die Hand zu nehmen und sofort seine Anträge zu stellen.“ Schon in der folgenden Sitzung wird der Plan dahingehend zugespitzt, daß „deshalb mit Herrn Buchhändler Merz in Unterhandlung getreten werden soll.“ Dieser gab ja auch die Jahrbücher des Literarischen Vereins heraus. Es kam aber nichts zustande. Ob das auch wieder an den peniblen Kritikern im Orden lag, denen die Auswahl überlassen wurde?
Winterling hatte zwei Lustspiele eingereicht: „Das Schiff aus der Levante. Lustspiel in einem Aufzug“ und einen zweiten Einakter „Die Pfälzer in Paris.“ Kress ließ ein Rundschreiben ausgehen, in das die Beurteilungen mehrerer Ordensmitglieder zum Archivieren eingelegt wurden, und dies alles wurde mit den Texten abgelegt. Es heißt da unter anderem:
Die Pfälzer in Paris
Ein leidliches Lustspiel; aber doch nicht mehr! Es kann passieren, wird aber auch keiner Sammlung zur Zierde gereichen. Handlung hat das Stück keine; Charaktere vollends gar nicht; das Interesse wird nicht gespannt; die Lösung durch das Belauschen der Gauner ist gar zu einfach u. des Engländers Freigebigkeit völlig unmotivirt; der Dialog überhaupt u. die politischen Expectorationen ziemlich mittelmäßig. […] Dr. Lösch
Ich trete der Ansicht des Herren Referenten vollkommen bei. Meines Erachtens würde eines wie das andere der beiden — sogenannten — Lustspiele jämmerlich durchfallen. Das erste (Die Pfälzer in Paris) ist weiter gar nichts als eine dialogische Anekdote, die sogar das Verdienst haben könnte wahr zu seyn […] Entschieden besser ist das Schiff aus der Levante. Aber auch hier beruht die eigentliche Verwicklung auf einer Absurdität die zu stark ist um sie dem Publikum aufzutischen. Denn man läßt sich Unwahrscheinlichkeiten z. B. daß seit 1828 bis 1850 eine verlassene Geliebte fort und fort auf die Wiederkehr des Geliebten hofft und harrt, daß sie mit ihrer Nebenbulerin zusammentrifft und einen lächerlichen Wettstreit mit dieser beginnt, usw. allerdings gefallen, weil solche Personen außer dem Schaden auch in der Regel den Spott haben und der Lächerlichkeit anheimgegeben sind […] Aber kein Publikum […] würde sichs gefallen lassen, die Pointe des Stückes in die Unmöglichkeit gesetzt zu sehen, daß der Held des Stückes, der zwar ein exzentrischer aber kein lächerlicher Mensch seyn soll, Faupris (wo in aller Welt hat denn der Dichter den vertrackten Namen her?) seine eigene 21 bis 22 jährige Tochter für ihre Mutter hält und nicht etwa blos flüchtig […] Ein Hauptgebrechen dieses wie des anderen Stückes ist, daß es schon lange vorher zu Ende ist als es aufhört. Der Beifall würde ein entschieden fortlaufender seyn. 14. April 1857 Lochner
Dann muß man eben die eigene Sichtbarkeit zurückstellen und seine kritischen Fähigkeiten an berühmten auswärtigen Gestalten erproben; möglicherweise kann man den einen oder anderen zum Beitritt als Ehrenmitglied veranlassen. Mönnich macht auf Geibel aufmerksam:
[…] Wie sollte nicht der Umstand, daß Emanuel Geibels Gedichte von 1840-50 zwanzig Auflagen erlebt, und folglich einen sehr bedeutenden Leserkreis gewonnen haben, mich rechtfertigen, wenn ich es versuchen will, in nachfolgendem Vortrage auf die Eigenthümlichkeiten hinzuweisen, welche dem immer noch jungen Dichter so beispiellosen Erfolge errungen haben. […]
[Die Formvollendung habe er durch seine Übersetzung aus dem Spanischen erhalten. Frühe Förderung durch Gewinn eines vom König von Preußen ausgesetzten Preisgeldes, das übrigens auch Freiligrath gewann. Dann oft auf Reisen.]
Aus diesem ganz flüchtigen Lebensüberblick tritt schon das mit Bestimmtheit hervor, daß Geibel ein höchst lebhafter, nach vielen Seiten sich wendender und einem höheren Ziele unermüdlich entgegenstrebender Geist ist. [Im Hinblick auf Formvollendung: „eine zweite Fleischwerdung Platen’s“]
Denn nirgendwo wird man auch nur die leiseste Spur von Bemühung, von Gezwungenheit wahrnehmen […] eigentlich die nothwendige Folge der dichterischen Empfindung und Anschauung […]
[…] mit einer gewissen Weichheit und Zartheit, Erregbarkeit u. Reizbarkeit, wir möchten sagen Jüngferlichkeit und Jünglingshaftigkeit […]
Ich betrachte ihn schon jetzt als einen über alle Dichter der Gegenwart, namentlich auch über Platen, Immermann, Heine, Lenau etc. Hinausgeschrittenen; weil es ihm vollständiger, als irgend einem gelungen ist, das Gebiet der Verneinung zu verlassen, und entschieden, entschloßen u. dabei heiter und ruhig den Boden der Bejahung , u. zwar der unbefangenen, freien Bejahung des Guten, Trefflichen, Edlen, Reinen, Göttlichen zu betreten, ohne in die Vergangenheit zurückzublicken, vielmehr indem er auf Gegenwart und Zukunft getrosten Muthes sein Auge richtet […]
Sondermann setzt sich in einem Vortrag vom 18. Januar 1858 mit Pierre Jean de Béranger, einem französischen Erfolgsschriftsteller, auseinander und läßt dabei ausnahmsweise seine wertkonservative, wenngleich nicht undemokratische Einstellung durchblicken, allerdings nur in der Einleitung. Die übrige Abhandlung ist 15 engbeschriebene Seiten lang, mit eingelegten Zetteln, geradezu philologisch angegangen mit Literaturverweisen, und läßt im übrigen keine moralische oder politische Tendenz erkennen. Anfangs aber reibt er es dem Autor hin:
Béranger war einer der Gründer jener liberalistischen Schule, deren zersetzende Prinzipien, unter den Massen verbreitet, die Katastrophe von 1830 und 1848 herbeigeführt haben; in dieser Beziehung verdiente er den Weihrauch, den man ihm streut, das Concert von Huldigungen, das man ihm anstimmt, obschon er wie alle seine Parteigenossen in der That nur für den Absolutismus gearbeitet hatte.
[…] Béranger besudelt das Bild seiner Großmutter (Ma grandmère) und seiner Amme […], er macht eine der zartesten Schöpfungen des Volksglaubens, den Schutzengel, zum Gegenstand seines Spottes, er stellt die barmherzige Schwester, das Schmerzensmädchen, mit den Opernsängerinnen, den Freudenmädchen zusammen. Die Freundschaft hat ihm nur zum Vorwand gedient, die Priester und die Ceremonien der Kirche auf das Heftigste anzugreifen […]
[…] Aber er hat damit nicht die Sache der Freiheit gefördert. Verkommenheit der Sitten begünstigt den Despotismus […] Er hat die vagen Ideen des Socialismus popularisirt und damit zur Vermehrung der Anarchie in den Geistern beigetragen, welche 1848 aus der Region der Ideen in die der Thatsachen herabstieg. […]
Auf einem eingeklebten Zeitungsausschnitt, mit Bleistift datiert „5. Aug 1857“, steht „Die N. Ztg. bemerkt: Es hat sich jetzt erwiesen, daß alle Berichte des ,Univers’ über Béranger’s schließliche Bekehrung zu jenen frommen Lügen gehören, welche die hiesigen kath. Blätter zur Erbauung ihrer Leser stets in Umlauf setzen, sobald eine hervorragende Persönlichkeit aus dem Lager der Ungläubigen von der Erde scheidet. Der Pfarrer von St. Elisabeth brachte allerdings die letzten Stunden bei Béranger zu, doch ließ ihn dieser nur als Freund und unter der Bedingung zu, daß er nicht mit Bekehrungsversuchen behelligt werde, und dies unterblieb denn auch.“
Mönnich sendet von Heilbronn einen Aufsatz „Über dichterische Behandlung der Geschichte, besonders im Drama“. Bemerkenswert ist daran zweierlei: Erstens der in die Handschrift eingelegte Zettel mit der Aufschrift „Es hat vor mehreren Jahren Mißstimmung erregt, daß ein Mönnichscher Aufsatz im literarischen Verein vorgetragen und zum Druck befördert wurde. Daher ist notwendig, daß der inliegende Aufsatz von jenem Verein fern gehalten werde. D. 31. May 1858 Dr. Lösch“. Dies zeigt, daß doch darauf geachtet wurde, gewisse Grenzen zwischen den beiden Gesellschaften nicht zu verwischen. Zweitens aber verrät Mönnichs Wertung verschiedener Klassiker, daß sowohl die Maßstäbe des Historismus als auch des Realismus zu greifen begannen.
[…] Der Schaden aber, den Dichter und Dichtungen höheren und höchsten Ranges stiften, wenn sie von der geschichtlichen Wahrheit sich gar zu weit entfernen, ist kaum zu berechnen. […]
Ich fange getrost mit dem Göthe’schen Götz von Berlichingen an. […] daß Göthe […] einen großen Mißgriff gethan hat, sofern es sich um die Schöpfung eines geschichtlichen dramatischen Gemäldes handelte. Denn er hat uns eben nur die Gährung, nicht das Große, nicht den Geist vorgeführt, der in ihr das Treibende, das Bedeutende, dichterischer Behandlung Würdige war. […]
In diesem [Egmont] treten uns ja alljene weltbewegenden Gedanken des Reformationszeitalters […] in einem so unvergleichlichen Gemälde entgegen […] Und dennoch! — Auch im Egmont hat Göthe das hohe Ziel, welches dem geschichtlichen Trauerspiel gesteckt ist, keineswegs erreicht […] weil er Geist und Pathos der geschichtlichen Vorgänge und Personen […] nicht ganz zu dem seinigen und zu dem seines Helden gemacht hat, der doch den lebendigen Mittelpunkt des Ganzen bilden sollte. […]
Schillers „Jungfrau von Orleans“ qualifiziert er ab, weil die geschichtliche Gestalt für eine Tragödie ausgereicht hätte, Schiller aber eine sentimentale Jungfrau daraus gemacht und die „Wirkung eines Rausches oder Traumes“ damit hervorgebracht habe. „Maria Stuart“ sei als Tragödie vollkommen, mache aber in den Hauptgestalten gewisse vorübergehende Gemütsstimmungen zur Voraussetzung des Handelns, die nicht allezeit vorgelegen hätten und den historischen Gestalten keine Gerechtigkeit widerfahren ließen.
Diejenige dramatische Dichtung, in welcher Schiller dem allerdings sehr hoch gesteckten Ziel der geschichtlichen Tragödie ganz nahe, näher getreten ist, als irgend ein großer deutscher Dichter vor und nach ihm, ist — nicht der Tell, sondern der Wallenstein. […] Ueberdies konnte er einen schuldlosen Wallenstein im Gedichte nicht wohl untergehen lassen; aber einen Wallenstein, der einzig und allein von verbrecherischen Absichten sich habe leiten lassen, konnte er ebensowenig für seine Tragödie brauchen. Er mußte ihn uns also menschlich näher zu bringen suchen. Die Größe der Wirkung welche Schillers Wallenstein hervorbringt, liegt nicht in den subjektiv idealen Zuthaten, die eher stören, sondern in der glücklichen dichterischen Behandlung des Gegebenen, des Realen, der Geschichte. […]
Nicht datiert ist ein Aufsatz von Sondermann über Goethes „Faust“, doch er paßt gut in diesem Zusammenhang. Unter fünf ideellen Gesichtspunkten erschließt er das Drama, 14 Titel der Sekundärliteratur sind aufgeführt.
[…] I. Das Ringen des Menschengeistes nach Wahrheit im Kampfe mit der menschlichen Beschränktheit […]
II. Das Ringen des Menschengeistes nach sinnlichem Genusse im Kampfe mit der Macht des Bösen […]
III. Das Ringen des Menschengeistes nach Wohlfahrt im Staate im Kampfe mit der Welt des Scheines, leichtsinniger Genußsucht und Scheinglück. […]
IV. Das Ringen des Menschengeistes nach vollendeter Kunst im Kampfe mit der Unvollkommenheit […]
V. Das Ringen des Menschengeistes nach menschenbeglückender Thätigkeit im Kampfe mit der bestehenden Ordnung und menschlicher Schwäche und Selbstsucht […]
Gewiß war es nicht Sondermanns Absicht, das Erleben des poetischen Werkes „Faust“ begrifflich einzukochen; zur ersten Erschließung der Gesichtspunkte hinter dem Drama sind seine Überlegungen jedoch tauglich. Davon, daß die ästhetisch berührende Oberfläche das ganze sogenannte Innere bereits enthält und ohne begriffliche Klarheit unmittelbar zur Anschauung bringt, hatte man um 1860 keine Ahnung mehr — oder noch nicht wieder. Schiller verstand man besser, aber nicht da, wo er Romantiker sein wollte.
Mit Platen hatte sich Sondermann schon seit 1851 befaßt; am 8. November 1858 und am 4. April 1859 trug er in öffentlichen Veranstaltungen des Ordens seine Würdigung vor, besonders die der Venezianischen Sonette.
Dietelmairs Auseinandersetzung mit klassischen Vorbildern nahm produktive Züge an; er griff die aus antiken Quellen, vor allem Petronius, geläufige Fabel der „Witwe von Ephesus“ auf und verquickte sie mit einem Ring und einem Fluch in einer Ballade, die Schillersche Anklänge zeigt: „Der Ring, oder Die Phantasie im Bunde mit dem Gewissen. Romanze“.
Zum Denkmal unserer letzten Stunde
Nimm diesen Kuß von meinem Munde
Und diesen Ring von meiner Hand.
Wär’s möglich, daß Du wankst, erneue
Dieß Zeichen der beschwornen Treue,
Was nur für mich Dein Herz empfand.
[…]
Wird je, bis meine Tage schwinden,
Der Reif an fremder Hand sich finden,
Dein Weib sich einem Andern nahn;
Dann mahne mich der Geist des Gatten,
Dann zünde fluchend mir sein Schatten
Der Hölle Hochzeitfackel an.
Nun darf ich, wirst Du einst erblassen,
Die treugeblieb’ne Hand dort fassen,
Wo nichts das Glück der Liebe stört.
Schon fühl’ ich unter Deinen Küßen
Den bittren Becher sich versüßen.
Spricht’s, neigt das Haupt, hat aufgehört.
Sie hält die fortbewegte Bahre,
Sie stürzt mit aufgelöstem Haare
Des Gatten frühem Hügel zu.
Wollt ihr die teuren Glieder haben,
Müßt ihr auch meinen Leib begraben;
Wo jene ruhn, ist seine Ruh.
Es geht weiter wie bei der Witwe von Ephesus. Einige Strophen später:
Er fleht, sie weint, sie ist bezwungen;
Ihr Herz, vom Lebensarm umschlungen,
Hat für die Todten ausgedacht.
Beim Tändeln mit den zarten Händen
Läßt leichtlich sich ein Reif entwenden.
Den letzten Kuß — nun gute Nacht!
[…]
In mitternächt’ger Stunde zeiget,
Die Brust zerwühlt, das Haupt geneiget,
Sich eine gräßliche Gestalt.
In ihrer Rechten lodern Flammen
Und schlagen über ihr zusammen
Mit des erfüllten Fluchs Gewalt.
Du weißst des Blitzes Lauf zu lähmen,
Das Meer durch Dämme zu bezähmen,
Und bist der Herrschaft dir bewußt.
Bald wird man zum Erstaunen hören:
Es kann der Mensch den Sturm beschwören;
Nur nicht den Sturm in seiner Brust.
Hast du das Band der Pflicht zerrissen,
Ist ein beleidigtes Gewissen
In seinem heil’gen Zorn erwacht
Und willst du seinem Arm entfliehen,
Hat es mit deinen Phantasien
Den grausenhaften Bund gemacht.
Stolz über seines Siegs Gelingen,
Begrüßt, den Reif zurück zu bringen,
Früh mit des Morgens erstem Roth
der Jüngling die bekannte Pforte
Und findet an dem theuren Orte
Die reitzende Geliebte — todt.
Das Besondere ist freilich die Verinnerlichung des Rachemechanismus, eine psychologisch gewagte Leistung, vorgebildet in den „Kranichen des Ibykus“ und fortgesetzt von Edgar Allan Poe.
Die Wochenversammlung macht sich Gedanken über das bevorstehende Schillerjahr, doch ohne verengten Blick; „,Ueber Shakespeare’s Hamlet. Entwickelung der künstlerischen Anlage aus der Grundidee des Dramas’ von Herrn Prof. Dr. Wölffel“, „Ueber Claudius, den Wandsbecker Boten“ (von Heller) und „Ueber den schottischen Dichter, Robert Burns“ (von Friedrich Rudolf Christian Schwemmer, Rechtskonzipient) sind weitere Themen.
Professionelle Schriftsteller als Mitglieder
Der Berufsschriftsteller ist in Deutschland eine Erscheinung, die im Vergleich zu anderen Ländern später zur Reife gelangte. Weder Sigmund von Birken noch Lessing hatten, streng genommen, vom Ertrag ihrer Werke leben können. Auch im 19. Jahrhundert brauchte es bei manchen, die man in der Öffentlichkeit nur als Dichter wahrnahm, eine Mischkalkulation. Als Maßstab der Professionalität stand nun allerdings ein äußerlicher zur Verfügung: die Auflagenhöhe auf dem Markt der verlagsmäßig vertriebenen Schriften. Und an diese Großschriftsteller wagte sich der Blumenorden nun heran.
„Am 18. März 1859. ebendaselbst
[…] 7.) H. OV. Dr. Lösch liest ein Antwortschreiben des H. OE. Dr. Kopp in München bezüglich des dortigen Dichters Geibel vor, in Folge dessen Geibel per acclamationem als Ehrenmitglied in den Orden aufgenommen wird.
8.) In gleicher Absicht soll an den H. Bibliothekar Scheffel in Donaueschingen geschrieben werden. Desgleichen sollen an andere Schriftsteller Schreiben erlassen werden.“
Hochgeehrter Herr!
Gestatten Sie mir Ihnen und den übrigen Mitgliedern des Pegnesischen Blumenordens meinen warmen und aufrichtigen Dank auszusprechen für die hohe Auszeichnung, welche Sie mir durch meine Ernennung zum Ehrenmitgliede Ihrer Gesellschaft zu Theil werden ließen! […] Sobald sich unter meinen ungedruckten Gedichten etwas findet, das mir einer Mittheilung in Ihrer Versammlung werth erscheinen dürfte, werde ich es Ihnen in Abschrift zugehen lassen. […]
München 26. März 1859.
Ergebenst der Ihrige
Emanuel Geibel
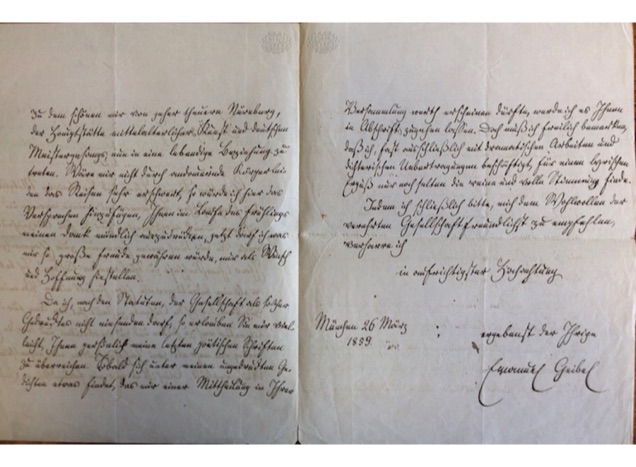
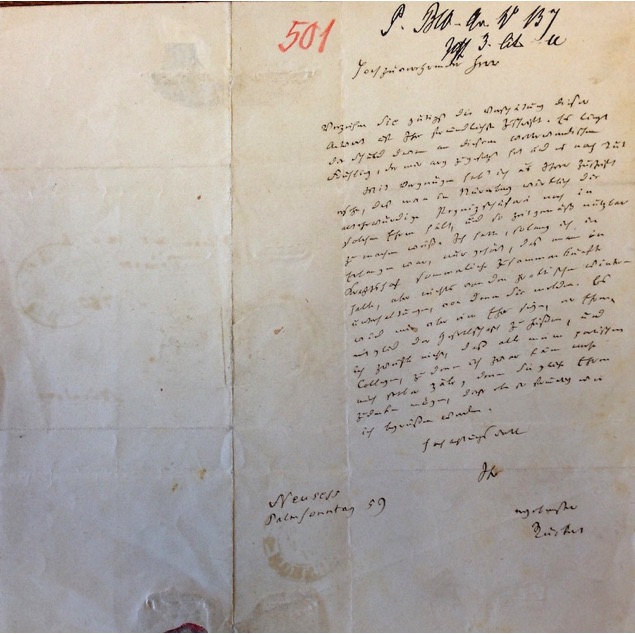
An Victor Scheffel:
„Nürnberg den 24t März 1859
Wohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Bibliothekar!
Die persönliche Bekanntschaft mit Eu. Wohlgeboren, die ich durch die gütige Vermittelung des H. Kirchenraths, Dr. Dittenberger, während des Jenensischen Jubelfestes zu machen die Ehre hatte, gehört auch zu meinen vielen ehrenwerthen und angenehmen Begegnissen bey diesem Festbesuche. Eingenommen schon für Sie, als geistreichen Schriftsteller, durch Ihren ,Trompeter von Säckingen’, und noch mehr durch Ihren ,Eckehard’ erfreute mich nun auch Ihre Persönlichkeit und dieselbe regte in mir den Wunsch auf, Sie als Ehrenmitglied unseres zweyhundert und fünfzehn Jahre alten Pegnesischen Blumenordens, dessen Schriftführer ich bin, zu wissen. Ich erlaube mir daher, hiermit bey Eu. Wohlgeboren anzufragen, ob sie nicht Lust haben, diesem altehrwürdigen Dichter-Orden als Ehrenmmitglied anzugehören, [mit Bleistift daneben in der freigelassenen Spalte dieses Briefkonzepts notiert: „ob Sie wohl die Ernennung zum Ehrenmitglied, die ich veranlassen würde, freundlich aufnehmen würden.“] dem noch jüngst der gefeyerte Dichter, Dr. Geibel, in München als solches beygetreten ist. Ich bin überzeugt, unser Orden würde sich durch Ihren Beytritt überaus geehrt fühlen. Sie selbst würden keine andre Verbindlichkeit über Sich nehmen, als von Zeit zu Zeit noch ungedruckte, geistige Erzeugnisse Ihres hochpoetischen Talents an denselbigen einzusenden, die sofort in seinen Versammlungen vorgelesen werden und dabey Ihr geistiges Eigenthum bleiben, über welches Sie frey verfügen können. Zur näheren Bekanntmachung mit unserem Orden lege ich dessen Gesetze bey, die im Jahre 1853. neu durchgesehen und verabfaßt worden sind.
Indem ich Sie ergebenst ersuche, mir bald Ihre gefällige Antwort auf meine Anfrage kund zu thun, empfehle ich Ihnen den Pegnesischen Blumenorden und mit demselbigen auch dessen derzeitigen Schriftführer angelegentlichst und versichere Sie der ungeheucheltsten Hochachtung, mit welcher ich bin,
Eu. Wohlgeboren
ganz ergebner
GEHC Seiler, Pfarrer an St. Sebald u.d.z. Ord. Schriftführer“
Geradezu postwendend:
„Donaueschingen den 28. Merz 1859.
Hochzuverehrender Herr Pfarrer!
Auf Ihre freundliche Zuschrift von 23t d. M. habe ich zu erwiedern, daß ich mit Vergnügen bereit bin, unter die auswärtigen Mitglieder des pegnesischen Blumenordens aufgenommen zu werden. Wenn auch mit wenig Anlagen zur Schäferei in Harsdoerfers u. Sigmund v. Birkens Styl begabt, hege ich doch so viel Vorliebe für die ehrwürdige deutsche Stadt Nürnberg und für Alles, was als lebensfähige, neuer Entwicklung sich nicht verschliessende Einrichtung aus alter Zeit in die unsere hineinragt, daß es mir eine Freude sein wird, Ihnen in dieser Form verbunden zu sein.
Ob ich durch Zusendungen fröhlicher deutscher Dichtungen Ihnen auch thätige Theilnahme zu beweisen im Stande sein werde, kann ich freilich zur Zeit nicht angeloben; trübe Lebenserfahrung, dienstliche Obliegenheiten u. strenge geschichtliche Studien haben mich seit Jahren zu einem stillen Mann gemacht. Sollte es in späterer Zeit von Sang u. Klang noch einmal in mir auftönen, so werde ich die Freunde an der Pegnitz nicht vergessen.
Mit freundlichstem Gruße
Ihr ergebener
Joseph Victor Scheffel.“
Gruß nach der Pegnitz.
Im Gartengrün beim Heimathhaus
Sitz ich am Tisch von Steine,
Hell blinkt zum Frühlingsblüthenstrauß
Der Festpocal mit Weine.
In Blumenhauch u. Maiweinduft
Entschweben die Gedanken
Vergnüglich weg durch blaue Luft
Zum biedern Land der Franken.
Mir ist, als seh ich Thor und Wall
Und Burg und Kirchen ragen,
Als hör’ ich Sang und Glockenschall
Aus grauer Vorzeit Tagen.
Und auf dem Markt begegnen mir
Befreundete Gestalten:
Des Wissens und der Künste Zier,
Die Reichstadtherrn, die Alten.
Den Dürer und den Willibald
Schau ich zusammen wandeln,
Der Eine wußte, wie man malt,
der Andre, wie zu handeln.
Und lächelnd winkt Hans Sachs den Gruß,
Der Meister hoch in Ehren,
Sein Spruch hieß einst: „Gesell man muß
Des Feindes brav sich wehren!“
So dank ich dem Gedächtnißblatt
Vom Pegnitzblumenorden,
O Nürnberg, theuerwerthe Stadt,
Daß Dein ich froh geworden!
Ist auch die Zeit kaum angethan
Im Irrhain sanft zu irren
Und himmelan zur Sternenbahn
Das Flügelroß zu schirren:
So lebt und webt doch kräftig fort
In unser aller Mitte
Der deutsche Geist, das deutsche Wort,
Die deutsche Art und Sitte.
Trotz arger Zeit und welschem Spott,
Wir pflegen sie in Liebe,
Fürs Weitre sorgt der alte Gott,
Und sorgen — deutsche Hiebe.
Ich aber füll’ mein Glas zum Rand
Und brings aus Herzensgrunde
Der theuern Stadt im Frankenland,
Dem Pegnitzblumenbunde!
Und das schon vom 22. Mai 1859 — Scheffel hatte seine trübe Phase wohl sehr schnell überwunden.
„Hochgeehrter Herr Pfarrer!
Die reiche Sendung [von erbetenen Auskünften über den Orden], die mir vor einigen Tagen zugekommen ist, kann ich nur mit meinem herzlichen Dank erwiedern. Ich bitte Sie, in meinem Namen es der Gesellschaft auszusprechen, wie sehr es mich freut, ihr nun anzugehören, wie lebhaft ich das Wohlwollen empfinde, das mir durch die Ertheilung des Ehrendiploms erwiesen worden ist. Ich darf hoffen, daß Sie an meinem Wunsch einer regen Betheiligung aus der Ferne nicht zweifeln werden, wenn ich in der nächsten Zeit dem Orden leider nichts mitzutheilen habe, was mir zur Einführung dienen könnte. Ich bin seit Monaten ausschließlich mit dramatischen Entwürfen beschäftigt […] mit aufrichtiger Hochachtung
München. 17. Mai 1859. Ihr
ganz ergebner
Paul Heyse.“
„Hochzuverehrender Herr,
Verzeihen Sie gütigst die Verspätung dieser Antwort auf Ihr [sic] freundlichste Zuschrift. Es liegt die Schuld daran an diesem wetterwendischen Frühling, der mir arg zugesetzt hat und es noch tut.
Mit Vergnügen hab ich aus Ihrer Zuschrift ersehen, daß man in Nbg. wirklich die altehrwürdige Pegnitz-Schäferei noch in solchen Ehren hält, und so zeitgemäß nutzbar zu machen weiß. Ich hatte, solang ich in Erlangen war, nur gehört, daß man in Kraftshof sommerliche Zusammenkünfte halte, aber nichts von den so aktiven Winterveranstaltungen, von denen Sie melden. Es wird mir aber eine Ehre seyn, ein Ehrenmitglied der Gesellschaft zu heißen, und ich zweifle nicht, daß alle meine geehrten Collegen, zu denen ich zwar kaum mehr zähle, denen Sie gleiche Ehren zudenken mögen, diese Ehre so freudig wie ich begrüßen werden.
Hochachtungsvoll Ihr ergebenster Rückert.
Neusess,
Palmsonntag 59“
Franz Schrodt nimmt sich einer neuen Veröffentlichung Heyses an, der zu dieser Zeit noch nichts zugeschickt hat:
Vortrag über Thekla von Paul Heyse gehalten in der öffentlichen Versammlung des pegnesischen Blumenordens zu Nürnberg am 6. Febr. u. 5. März 1860 im Sale des rothen Rosses […]
Hatte er in seinen früheren Dichtungen sich an den besten Mustern teutscher und fremder Literatur angelehnt, ohne jedoch einen guten und großen Theil Eigenthümliches vermissen zu lassen, so liegt bereits in seinem Gedichte „Die Braut von Cypern“ welches vor einigen Jahren Gegenstand eines Vortrages in unserem Orden gewesen ist, der Beweis vor, daß seine selbstständige starke Individualität die Einflüsse anderer Geistesheroen zerbrochen hat.
Dieselbe Selbstständigkeit waltet in seinem neuesten Gedichte „Thekla“ einem Epos in neun Gesängen.
[…] Das Gedicht versetzt in die ersten Zeiten der Ausbreitung des Christenthums unter den Griechen. […]
Die Darstellung ist rücksichtlich der Personen und der öffentlichen Zustände durchaus der Zeit gemäß, in welcher die Handlung des Epos sich bewegt. […] die Wunder göttlicher Hilfe sind mit natürlichem Zusammenhange der Begebenheiten in Verbindung gebracht, und anziehende Schilderungen von Naturschönheiten in die Dichtung verwoben. […]
Geibel allerdings übersendet am 25. Februar 1860 einen Brief, eingelegt neun ungedruckte, von Schreiberhand abgeschriebene, von Geibel selbst am Ende handsignierte Gedichte. Davon wird zumindest folgendes in der Versammlung vom 16. März 1860 durch Dr. Lösch vorgelesen:
Mondbeschienen lag Athen,
Lag der Oelwald rings im Grunde,
Als ich zu den Propylä’n
Einsam klomm in später Stunde.
Oft im Dunkel ging der Pfad
Ueber Schutt und moos’ge Platten,
Aber plötzlich schimmernd trat
Pallas Tempel aus den Schatten.
Riesenhaft im weißen Schein
Klar bis auf den Bruch der Fugen,
Streckten sich die Säulenreihn,
Die den mächt’gen Giebel trugen.
Lang bewundernd stand ich da,
Mir der Vorzeit Bild, das helle,
Rückbeschwörend, bis ich sah,
Daß ich nicht allein zur Stelle.
Auf den Stufen saß ein Weib
Regungslos, als ob es harrte,
Das mit vorgebognem Leib
In’s Getrümmer niederstarrte.
Weit umfloß und faltenreich
Fremde Tracht die edlen Glieder,
Um die Schultern wellengleich
Rollte Goldgelock hernieder.
Jetzt erhub sie das Gesicht,
Drin sich Gram und Hoheit einte,
Und im klaren Mondenlicht
Sah ich deutlich, daß sie weinte.
Leisen Schrittes wollt’ ich nahn,
Da, vom Fuß der nahen Säule
Glüht’ ein roter Blitz mich an
aus den Augen einer Eule.
Und mir war’s, als käm im Wind
Geisterhauch dahergeschauert —
Sah ich Zeus blauäugig Kind,
Das um seinen Wohnsitz trauert?
Normalbetrieb
Unerachtet der Beiträge von den und über die prominenten Neumitglieder hatte die Tätigkeit des Sichtens und Vorstellens den Hauptanteil an den Wochenversammlungen. Zu dieser Zeit tat sich besonders der Gymnasialprofessor Dr. Wölffel mit drei Shakespeare-Vorträgen hervor, nur unterbrochen von einem Gelegenheitsgedicht „Festode zu Philipp Melanchthons dreihundertjährigem Todestag am 19. April 1860 von Dr. Heinrich Wölffel. Nürnberg.“
Die Serie aber begann mit „,Ueber Shakespeare’s Timon’, in 2 Abtheilungen“ und setzte sich fort mit „Ueber Shakespeare’s Hamlet“, worin der Verfasser sich von Goethes Interpretation absetzt: „[…] indem ich den Versuch wage, die künstlerische Anlage dieses Drama’s aus der ihm zu Grunde liegenden Idee abzuleiten. […] Müßte ich nämlich in Hamlet eine schwache Seele sehen, auf welche eine große That gelegt ist, der sie sich nicht gewachsen zeigt, so würde ich nie mehr im Stande sein, aus diesem Grundgedanken die wunderbare Composition eines so reichen, lebendigen Gemäldes zu erklären; […Shakespeare habe jeweils nur eine Leidenschaft zum Thema einer Tragödie gemacht.] Nur in zweien, und freilich in den großartigsten seiner Dramen ist er über dieses engere Maß hinausgeschritten, im König Lear und im Hamlet. Denn indem in diesen beiden Stücken den Menschen als solchen, in dem vollen Gewicht seiner Stellung und seines Vorrechts, man darf sagen, als die Krone aller irdischen Schöpfung, zum Gegenstand tragischen Geschickes macht […] im Hamlet offenbar die sittliche Würde des innern Seelenlebens betont und im Auge behalten ist. […]“
Seine unzeitgemäße Serie über Barockdichter setzt Georg Neumann fort: „Vortrag im pegn. Bl.-Orden d. 3. Decbr. 1860. Über den Dichter Johann von Besser 1654-1729 und seine Gattin Elisabeth geborne Kühlewein 1662-1690“
[…] Niemand kehrt zu seinen Gedichten zurück, obgleich sie ihm, wie Gervinus richtig bemerkt, „Vornehmheit und Lohn brachten, wofür ja heutzutags mancher Dichter den Lorbeer der Nachwelt drangeben würde.“ […] daß selbst der berühmte Leibnitz [sic] im J. 1700 eines seiner Gedichte der verehrten Kürfürstin Sophie von Hannover übersandte, die es dann der verwitw. Frau Herzogin von Orleans aus dem Kurhause Pfalz nach Paris mittheilte […] [Es folgt eine genaue Nacherzählung seines offenbar sehr bewegten Lebens. Als seine Frau ihm gestorben war (1688):] Es sind ihr zu Ehren mehr als 30 Trostschriften und Leichengedichte, Zum Theil von sehr vornehmen Personen gesetzt worden, [u.a. von] dem Senator Carpzov daselbst, ein lat. Brief von Samuel von Pufendorf u. ein gleicher von Joh. Friedrich Cramer nebst einer deutschen Abhandlung von Christian Thomas, Bessers Schwager in Leipzig […]
B. aber, von dem sein Biograph meint, „daß er den Namen u. den Tugend-Ruff seiner Geliebten in s. herrlichen Schriften wie sich selbst durch s. vortreffliche Feder unsterblich gemacht hat“, sprach seinen grenzenlosen Schmerz sowohl in einigen kleineren Gedichten, als besonders in einem längeren Gedichte aus „Verhängniß getreuer Liebe“, das lange Zeit hindurch in der elegischen Dichtkunst als ein Meisterwerk bewundert u. als ein Muster gepriesen worden ist. Das Urtheil der Gegenwart wird ihm freilich dieses Lob versagen. Dennoch wird uns dieses Werk trotz seiner breiten Anlage u. wortreichen Ausführung noch heute ergreifen, indem es den Schmerz der Trennung so rührend darstellt und allen Gefühlen von der heftigsten Leidenschaft bis zur stillen Wehmuth die nach Worten ringt, Ausdruck verleiht. […]
[…] lassen wir dieses rühmende Urtheil für damals gelten und gestehen, daß er dazu beigetragen hat die deutsche Sprache aus ihrem fremdländischen Wortschwall und ihrer steifen Unbeholfenheit, selbst bezüglich der Prosa, herauszubilden. Ein Glied an der großen Kette der fortschreitenden Entwicklung der deutschen Literatur ist auch Besser gewesen, wenn gleich jetzt sein Name am Sternenhimmel der Poesie durch die goldnen Lichter eines späteren Zeitalters längst verdunkelt worden ist.
Unter den geplanten öffentlichen Vorträgen ist ein ganz aktueller, dessen Gegenstand nicht ohne politische Delikatesse ist: „H. OV Dr. Lösch: ,Ueber das Drama Franz von Sickingen, von Lasalle’“50. Das Drama war erst 1858 erschienen, der Verfasser war ein Sozialdemokrat, der allerdings dem Bürger kein gar solches Schrecknis war wie Karl Marx, weil er eher genossenschaftlich und preußisch gesinnt war als revolutionär und internationalistisch. Doch auf jeden Fall war der „Sickingen“ kein Ausdruck der erwähnten Butzenscheibenromantik.
Bemerkenswert ist auch, daß der Orden eine weitgehend mittellose Autorin unterstützte, von der zunächst nichts als literarische Erstlinge vorlagen:
„Nürnberg, den 18. October 1861. in der Wirthschaft zum Regensburger Hof des H. Errmann
[…] 6.) […] c.) H. Pf. Heller: einen Brief von H. Buchhändler Merz, die Dichterin Schilfarth zu Schwabach und deren Unterstützung betreffend. Nach dem Beschluße will man abwarten, was der lit. Verein für dieselbige thut und sich weitere Entschließung vorbehalten. […]
Nürnberg, den 15. November 1861. ebendaselbst
[…] 4.) Auf die von H. Prof. Dr. Wölffel dem H. OV Dr. Lösch gemachte, günstige Mittheilung über die Dichterin, Schilfarth wird beschlossen, daß mittelst eines Umlaufschreibens für sie Geldbeyträge gesammelt werden sollen, die ihr dann als Geschenk zu überreichen seyen.
[…] 7.) […] b.) H. OV Dr. Lösch: Ein Bruchstück aus dem Schilfarth Drama „Max Emanuel“ […]
Geschehen am 20. December 1861. ebendaselbst
[…] 2.) bemerkt der H. OV Dr. Lösch, daß der Dichter, H. Julius Hammer und die Dichterin, Jungfrau Schilfarth zu der letzten, öffentlichen Versammlung eingeladen wurden und auch erschienen sind. Ersterer erklärte sich bereit, von seiner Kunst, Schauspiele vorzutragen, in einer öffentlichen Versammlung Beweise zu geben, was mit Vergnügen angenommen ward.
3.) Derselbe zeigt hierauf an, daß die gesammelten Beyträge zum Unterhalt der Dichterin, Schilfarth, 58 fl. 45 xr. betragen haben. H. Georg legt noch 1. fl. 15. xr. dazu, um die runde Summe von f. 60 voll zu machen und die f. 2 Einsammlungs-Kosten werden von der Ordenskasse bestritten. […]
Geschehen am 19. Xbr. 1862. ebendaselbst
[…] 7.) Für Jungfrau Schilfarth, zur Zeit in Granson im Pensionat soll wieder eine Bitte um Unterstützung mittelst Umlaufschreiben im Februar an die Ordensmitglieder gerichtet werden. […]
Nürnberg, den 23. Februar 1863. ebendaselbst
[…] 4.) H. OV macht bekannt, daß die Sammlung für Jungfrau, Henriette Schilfarth von den Ordens-Mitgliedern f. 83. eingetragen hat.“
In demselben Protokoll werden zwei Vorträge für die öffentliche Versammlung angekündigt, die wieder etwas altdeutsch-orientiert anmuten:
„[…6.) öff. Vorträge:] b.) H. OV Dr. Lösch: ,Brunhild von Geibel und und die Nibelungen von Hebbel’; […]
d.) Dr. Hauck: ,Ueber Bayerns Antheil an der Entwicklung der altdeutschen Dichtkunst’“
Mit der Produktion Nürnberger Mitglieder beschäftigt man sich sehr zeitnah:
„4.) Nun tragen vor:
[…] d.) H. RR Schrodt ,Quitt’ oder Nürnberg im Jahre 1862. von Dr. W. Beckh.“
Zwei Jahre nach dem Tod von Michahelles hatte Sondermann schon einen seiner gewichtigen Aufsätze über dessen Gedichte verfaßt und vorgetragen. Daß jedoch ein Werk eines noch lebenden und an der Besprechung teilnehmenden Mitglieds auf die Tagesordnung kam, wirkt schon beinahe wie ein Werkstattgespräch unter Schriftstellern.
Kein Zweifel, die Wochenversammlungen hatten Niveau und Aktualität:
Geschehen, Nürnberg, den 18. 7br. 1863. ebendaselbst
[…] 3.) Hierauf übernimmt auf Ersuchen des neuen H. Ordensvorstehers der Schriftführer die Leitung der Verhandlungen und trägt vor:
[…] b.) daß das Ehrenmitglied, H. Jos. Victor Scheffel, Archivar auf der Wartburg, dem Orden ein Geschenk mit einem Prachtexemplar seines neuesten Werkes „Frau Aventiure“ gemacht hat […]
c.) daß Herr R. Boissière, zu Paris dem Orden ein Schriftchen zuschickte, betitelt: „Du progrès dans les Langues par une direction nouvelle donnée aux travaux des Philologues et des Académies“ von welchem die Versammelten auch eine Einsicht nehmen. […]
4.) Weiter zeigt der Ordensschriftführer an, daß er des Ehrenmitgliedes, H. Priem’s Schriftchen „Rupprechtstegen und das Pegnitzthal“ um 13 xr. für die Ordensbibliothek angeschafft hat und bittet um Nachgenehmigung des Kaufs, die ihm auch zu Theil wird.
5.) Endlich zeigt derselbige die dem Orden übermachten Photographien der Ordensmitglieder: H. Pf. August Lösch allhier u. H. Oberbibliothekar Minzloff in Petersburg, vor und dem Beschluße gemäß soll ein Album der Ordensmitglieder im kleineren Format angelegt werden.
[…] 8.) Endlich schreitet man zu Vorträgen und es liest zu dem Ende vor:
[…] b.) der Ordensschriftführer: eine bisher noch unbekannte Reliquie von Göthe aus dem Jahr 1775 u. ff. betitelt: „Salomons, Königs v. Israel und Judä güldene Worte von der Erde bis zum Ysop“
Damit schließt man.
Aus der Periode der Kriege
1864.
Eines neuen Frühlings Ahnen
Brach durch WintersSturm und Nacht,
Vor uns frische Kampfesbahnen,
Hinter uns die Redner-Schlacht!
Also grüßte Dein Erscheinen
Hoffnungsvoll die halbe Welt,
Doch der Menschen Sinn und Meinen
Hat der nächste Tag zerschellt.
Jahr der Hoffnung und des Truges,
Welche Frucht hast du gereift?
In den Blättern deines Buches
Ist nur neuer Stoff gehäuft, —
Neuer Stoff zum alten Streite,
Blutgen Lorbeer um das Haupt,
Sieht Germania sich heute
Siegerin — und doch beraubt!
In den Schnee am Meeresstrande
Rann der Tapf’ren treues Blut,
Nieder rasselten die Bande,
Rasch gelöst vom deutschen Muth;
Und von vielen, die da siegten,
Bleibt im Sande das Gebein, —
Ach, wie falsche Träume wiegten
Sie im Todesschlummer ein!
Träume von der Siegesfreude,
Die ganz Deutschland überstrahlt,
Während unsre Wangen heute
Nur des Zornes Röthe malt; —
Wenn aus frech gewecktem Grolle
Neuen Streites Flamme bricht
Keimt aus blutgetränkter Scholle
Wohl des Friedens Blume nicht.
Ferne über Meeresfluthen
Wüthet noch der harte Streit,
Und entflammt von seinen Gluthen
Ist der Himmel hoch und weit.
Überall bedeckt die Flammen
Eine trügerische Schicht,
Drohend, daß in sich zusammen
Zweier Welten Schicksal bricht!
Wohl erklang die Friedensharfe
Doch wen täuscht ihr süßer Ton?
Fiel dem Spieler doch die Larve
Allzurasch vom Antlitz schon, —
Täuschung nur war dein Gewerbe,
Altes Jahr, durch deine Bahn, —
Und ein ungewisses Erbe
Tritt das neue zagend an.
Steige nieder zu dem Raume,
der in Clio’s Reich gehört,
Dort versenke was im Traume
Falscher Hoffnung uns bethört,
Und mit kühnem Schwingenschlage,
Neues Jahr, beginn den Flug,
Bring uns sonnenhelle Tage,
Reiß entzwei des Nebels Trug!
Lenke ab die Wetterwolke,
Dulde nicht das frevle Spiel, —
Bei den Mächt’gen, bei dem Volke,
Wahr des ew’gen Rechts Gefühl!
Nur der heil’ge Zorn der Väter
Ob des langen Unrechts Nacht,
Warf einst in des Schicksals Räder
Des verhaßten Drängers Macht.
Bring uns Eintracht, bring uns Segen,
Bring uns Frieden, junges Jahr,
Führ’ die Herzen sich entgegen,
Mach’ die Bruderliebe wahr!
Wehre allen wilden Stürmen,
Hege was der Friede beut,
Alle seine Güter schirmen
Möge eine schön’re Zeit! —
Lenkt auf wechselvollen Wegen
Auch die Muse ihren Schritt,
Laß nicht Dornen sie umhegen,
Bring ihr frische Blüthen mit.
Und Du, ew’ger Herr der Zeiten,
Schütze dieses Jahres Gang,
Daß ihm bringe einst beim Scheiden
Unsern Dank der Glocken Klang! —
J. Priem
Dieser Reflex auf den deutsch-dänischen Krieg läßt sich nicht von ungefähr auf die Melodie des Deutschlandliedes singen.
Natürlich endigt mit dem Entsetzen über einen regional begrenzten Konflikt noch nicht alle Normalität im Vorgehen einer Gesellschaft wie des Blumenordens. Besonders gute Nerven hatte man in München — vorerst. Das scheinen die Beiträge der neuen Ehrenmitglieder aus dieser Residenzstadt zu erweisen, jedenfalls, insofern sie humoristisch sind.
„[…] 2.) Sodann liest der Herr OV die auf die Sendung der den Ehrenmitgliedern H. Gf. Pocci und Prof. Dr. von Kobell ausgestellten Diplome eingelaufenen Danksagungs-Schreiben, denen die Photographien dieser Herren beygeschlossen waren nebst einigen ihrer herausgegebenen Werke, u. zw. von H. Gf. Pocci:
a.) Todtentanz in Bildern und Sprüchen;
b.) Der Karfunkel. Volksdrama in drey Aufzügen;
c.) Der Landsknecht; und
d.) Der wahre Hort, oder die Wemdinger Goldsucher. Drama in vier Aufzügen. Als Manuscript gedruckt.
Von H. Prof. Dr. v. Kobell:
a.) Die Urzeit der Erde. Gedicht;
b.) Gedichte, hochdeutsche;
c.) Schnaderhüpfeln, und Sprüche;
d.) Gedichte in oberbayerischer Mundart, und
e.) Gedichte in pfälzischer Mundart.“
Übrigens fällt auf, daß in diesen Jahren fast keine Sitzung vorbeigeht, ohne daß Gedichte von Geibel am Ende vorgelesen werden.
Konvivialität bei akademischen Anlässen — Kobell ist ganz in seinem Element:
Zur Stiftungsfeier der Ludwig-Maximilians-Universität München 1865.
Magnificus.
Wie hat Magnificus gelernt
Das Bilder-Restauriren,
Das will ich Euch, so gut ich kann,
In Kürze expliciren.
Er sah an manchem alten Kopf
Der lieben Herrn Collegen
Ein jugendliches Farbenspiel
Beim Becherklang sich regen,
Er sah von edlen Weines Macht
Den Staub der Jahre schwinden
Und jeden wieder frischen Glanz
In seinem Hauche finden.
Da dachte der Magnificus,
Es ist an diesem Wunder
Das Agens nur der Spiritus,
Das Andere ist Plunder.
D’rum dampfte er gleich Alkohol
Auf alte Wouvermänner,
Die ganz verwittert und vergilbt
Unkenntlich jedem Kenner,
Und sieh! Das Wunder hat gewirkt,
All’ sind sie jung geworden
Und spielten wieder Farbenglanz
In herrlichen Accorden.
So lernt denn d’raus, am Weine nun
Euch doppelt zu erfreuen
Und laßt uns seinen Spiritus
Dem Rector heute weihen.
Fr. v. Kobell
Dieser spielte mit:
Ich Maximilian Joseph Pettenkofer
für dieses Jahr frei gewählter Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität kröne dich Franz von Kobell mit Lorbeer, der du nicht nur als Lehrer und Erforscher jener Weisheit, welche der liebe Gott im Reiche der Steine ausgestreut hat, sondern auch als sinnreicher Sänger, der schon viele ernste Männer erheitert hat, weit und breit berühmt bist, und ernenne dich zum ersten lorbeergekrönten Dichter der Universität. […]
München, den 26. Juni 1865.
(L. S.) Dr. Maximilian Joseph Pettenkofer
Dieser Humor funktioniert aufgrund der komischen Fallhöhe von feierlichen Worten sowie erhabenen Vorstellungen hinab zur einfachen, wenn nicht sogar banalen oder gar blamablen Wirklichkeit. In ähnlicher Weise, sogar noch drastischer im Unterschied, erfreut der gemütlich abschwingende Vergleich im Fall der durch einen Blitz im Wintergewitter in Brand gesetzten und wieder aufgebauten Spitze des Nordturms von St. Lorenz in Nürnberg:
Wie dein Patron Laurentius
Einst in der grauen Vorzeit Tagen,
So hast Du nach des Himmels Schluß
Ein grauses Marterthum ertragen:
In Flammen solltest Du vergeh’n,
Und doch in Ehren neu ersteh’n.
„Die Thurmspitze aus Eisenblech wurde in der v. Cramer-Klett’schen Fabrik nach der Konstruktion des Herrn Direktor Werder gefertigt.“ Der heutige Nürnberger verdeutlich sich das so: Aha, die spätere M.A.N. hat das neueste Material statt des Kupfers eingesetzt, und der Ingenieur, nach dem später die Arbeiter-Gartenstadt Werderau benannt wurde, hat die Lasten berechnet.
In der Kategorie „Mundart“ beschränkt man sich nicht auf das Bairische, Fränkische und Pfälzische. Dr. Beckh trägt am 15. März 1865 ein Gedicht in plattdeutscher Mundart von Fritz Reuter vor — man wüßte gern, wie. Dies kontrastiert wohl auf das anmutigste mit Dr. med. Ernst Solgers „Reiseskizzen über den Aufenthalt in Rom“. Dieser versucht sich aber auch an „Wolfram von Eschenbach“ einem Gedicht in sechs Gesängen. Am 26. Februar 1869 referiert er wieder über Rom, und zwar über dessen Eroberung, und am 28. Oktober 1869 mysteriöserweise über „etwas, was nicht in das Protokoll, seinem Verlangen gemäß, kommen soll“; im Mai 1870 ist er wegen Wegzugs aus dem Blumenorden ausgetreten.
Unterdessen kam es zum Krieg zwischen dem Deutschen Bund unter Führung Österreichs und Preußen. Wenn folgendes Gedicht von Euler-Chelpin auch erst auf 20. November 1868 datiert ist, so dürfte dies das Datum des Vortragens sein; es nimmt deutlich bezug auf nahe Kriegsschauplätze innerhalb Deutschlands.
In der Bahnwärter-Hütte
Tief bekümmert in der Hütte
Sitzt der alte Wärter da
Stammelt wiederholt die Bitte:
„Gütiger Vater! bleibe nah
Meinem Sohne, der dem Feinde
Kämpfend gegenüber steht, —
Daß ich ihn noch einmal sehe,
Eh’ mein Leib zur Erde geht!
Hat sich auch seit vielen Jahren
Manches Leid um mich geschaart,
Doch von drohenden Gefahren
Hast Du gnädig mich bewahrt. —
Ach! so trage Du hinieden
Über jetzt auf meinen Sohn
Was Du Gutes mir beschieden, —
Gieb es ihm als Gotteslohn.“ —
Sorgenvoll schließt sich dem Greise
Auch die Mutter betend an:
„Großer Gott! Du bist allweise
Was Du thust ist wohlgethan.“
Horch! Da tönt’s wie ferner Donner. —
Doch der Himmel ist ganz rein. —
Das ist nicht der Räder Rauschen,
Kann der Wagenzug nicht seyn.
Und die beyden Alten eilen
Schleunigst nach der Schienenspur;
Die besorgten Blicke weilen
Auf der weit entfernten Flur.
„Das ist Donner der Geschütze!
Hörst du der Trompete Schall?
Siehst du nicht die Feuerblitze?
Pulverdampf all überall? —
Schon neigt sich der Tag zu Ende,
Doch der Schlachtruf tönt noch fort;
Betend hält der Greis die Hände:
„Vater! sey ihm Schutz und Hort!“ —
Endlich bey des Nachts-Dunkel
Wird der Schlachtkampf eingestellt. —
Doch der Sterne Lichtgefunkel
Sieht nicht mehr manch braver Held.
Auch der Wärter, sorgenmüde,
Hat zur Ruhe sich gelegt;
Mit bekümmertem Gemüthe
Bleibt er schlaflos aufgeregt.
Da vernimmt er leise Tritte,
Höret jetzt Soldaten nah’n; —
Ja sie kommen an die Hütte,
Pochen an der Hütte an.
Wie verjüngt vom Lagerorte
Eilt der alte Vater schon,
Öffnet rasch die kleine Pforte,
Rufet laut nach seinem Sohn.
Keine Antwort läßt sich hören.
Schweigend treten Krieger ein,
Tragen schonend auf Gewehren
Jetzt den toten Sohn herein.
„Armer Mann! Die letzte Bitte
Eures Sohn’s vernahmen wir:
„Bringt mich in der Eltern Hütte,
Danken werden sie dafür.“ —
Dieser Wunsch ist ihm erfüllet,
Und der Sohn euch zugestellt.
Daß Eur’ Schmerz auch sey gestillet
Wißt, — er starb als braver Held.“ —
Und der Vater kniet nieder,
Küßt des Todten Angesicht.
„Meinen Sohn! Ich sah ihn wieder,
Gott verwarf mein Flehen nicht!“ —
Auch die Mutter nahet leise,
Blickt den Sohn und Vater an:
„Ja mein Gott! Du bist allweise
Was Du thust ist wohlgethan.“
Bei aller Einfühlung in die armen Alten konnte man so die lesende Öffentlichkeit im Namen des „Herrn der Heerscharen“ auf weitere Opfer vorbereiten. Daß diese bei einem zu erwartenden Waffengang mit Frankreich unvermeidlich sein würden, war ein offenes Geheimnis.
Rückert starb am 31. Januar 1866. Am 16. Februar 1867 protokolliert Seiler: „4. Endlich übergibt H. Dir. Rehm die für die Büste des Fr. Rückert gesammelten 16. fl. zu welchen noch 12. fl. beygetragen werden. Diese 28. fl. wird H. Ord. Vorsteher an das Komitee in Coburg einzusenden die Güte haben.“
Damit hat es nicht sein Bewenden: „1.) Vorauszuschicken ist, daß in der jüngsten, nicht öffentlichen Versammlung am 8. dieß vorgetragen wurde:
a.) von OR Dr. Heerwagen aus den gedruckten, neuen Octaven des OM H. Prof. Dr. Winterling zu Erlangen, von denen an den Orden ein gebundendes Exemplar zum Geschenk gemacht und dasselbige mit einem bey dieser Gelegenheit vorgelesenen Schreiben an den Ord. Schriftführer begleitet hat, diejenigen Strophen von 309. an, die an den Dichter Rückert gerichtet sind; […]“
Herr Pfarrer Petzet vermeinte wohl, die Überlieferung von dem Judenpogrom im Jahre 1349 mit einer erfundenen Fabel schönen zu können. Immerhin durfte sich 1850 erstmals wieder ein Jude als Bürger in Nürnberg niederlassen, und die jüdische Gemeinde war am Wachsen. Ob Petzet dies als bedrohlich erlebte oder diesen Neubürgern die Nürnberger Geschichte begreiflicher machen wollte, steht dahin. Gut kommen die Juden in folgendem Gedicht allerdings nicht weg: „Schön Bunle. Ein Gedicht in vier Gesängen von Johannes Heinrich Petzet. Nürnberg, 1868. Verlag der Joh. Phil. Raw’schen Buchhandlung. (C. A. Braun.)“ Daraus:
XI.
„Gott’s Wunder!“ kreischt der Jude auf,
„Herr, seid doch nicht so unbarmherzig
Und laßt mir gnädig meinen Lauf!
Gebeugt bin ohnedies vom Schmerz ich,
Denn wißt, es ist der Tochter Leiche,
Die ich will führen weit von hier,
Damit in Frieden ich von ihr
Auch bald ins Grab hernieder steige!“ —
Dem Hauptmann, was der Jude sagt,
Weil ihm dies Treiben nicht behagt
So ganz geheimnißvoll und nächtig.
Er denkt an all die bösen Sagen
Von manch geraubtem Christenkind,
Das von den Juden ward erschlagen,
Und er befiehlt: „Macht auf geschwind
Und ohne Zögern mir die Truhe!
Ist’s. wie du sagst, will ich die Ruhe
Der Todten länger stören nicht,
Wo nicht, so droht das Strafgericht!“
XII.
Der Deckel fällt. Beim Fackelschein
Der junge Hauptmann schaut hinein.
Und sieh’ ganz regungslos und bleich,
Von ihrer Schönheit Glanz umflossen,
In enger Truhe eingeschlossen,
Liegt Bunle da, dem Bilde gleich,
Das durch des Künstlers fleiß’ge Hand
Aus weißem Marmor auferstand.
Der Hauptmann staunt und steht entzückt
Ob solcher seltnen Schönheit Pracht.
Es zieht zur Jungfrau ihn mit Macht,
Bewundernd er sich zu ihr bückt;
Er faßt sie an der schlaffen Hand,
Die er voll Jugendfeuer drückt:
„ O Gott, so schöne junge Maid
Hab’ ich mein Leben nie geschaut,
Warum mußt’ sie des Todes Braut
Schon werden in der Jugendzeit!“ —
Und sieh — die kalte Hand wird warm,
Es hebt sich leis empor der Arm,
Der Mund scheint Seufzer auszuhauchen,
Es öffnen langsam sich die Augen,
Zwei Augen, ach so himmlischmild!
Der Jüngling sieht’s entsetzt — und wild
Reißt sich der alte Jude los,
Versetzt dem Jüngling einen Stoß,
Schwingt sich auf’s Wäglein, peitscht das Pferd,
Und durch die Nacht dahin er fährt,
Bis sich der Hauptmann recht besonnen,
Ist mit der Jungfrau er entronnen.
Nichts hilft jung Walthers Schmäh’n und Grollen,
Kaum hört er noch den Wagen rollen;
Verschwunden wie ein Spuk der Nacht
Ist Alles ihm, und heimlich lacht
Das Wächterpaar und schließt das Thor,
Indem sich trösten still die Beiden:
„Und müssen wir auch Strafe leiden,
Uns hat der Jud’ bezahlt zuvor!“
Der Jude Nathan erdolcht am Schluß noch Walther, und die Juden werden aus Nürnberg vertrieben. Sie nehmen es als Gottes Strafgericht an. Wofür Gott alles herhalten muß!
Einen poetischen Jahresrückblick auf den Orden im Jahre 1868 liefert Valerie Schrodt in Versen, die reichlich konventionell und nur gelegentlich von einem Blitz unerwarteter Poesie durchzuckt sind. Auszugsweise lauten sie:
Pegnesia 1868.
Es steht in des Jahres Mitternacht
der alte Dezember auf der Wacht,
Und schaut durch Wetter, durch Sturm, und durch Graus
In die Nebelerfüllte Welt hinaus.
Er denkt zurück an jede Zeiten,
Wo elf Genossen er durft begleiten,
Er denkt zurück an ihr Leben und Lieben,
Und an das, was von alledem nun geblieben.
Wie hatten sie sie so innig verehrt,
Pegnesia, die Allen so lieb und werth,
Die Jungfrau, den Pegnitzschäfern entstammt,
Die Herz und Gemüthe heftig entflammt,
Wie wollte ein Jeder ihr Ritter gern sein,
Wie wollten sie Dienste mit Freuden ihr weih’n.
Der sonst so frost’ge Januar
Ganz warm in ihrer Nähe war.
Er durfte ihr das Jahr erschließen,
Und trat hervor, sie zu begrüßen;
Er wußt’ die besten Wort’ zu wählen,
Konnt sie belehren, ihr erzählen,
Indeß der Feber, voll Humor,
Ihr flüstert muntren Scherz in’s Ohr,
Und hell die Gläser ließ erklingen,
Manch heitern Trinkspruch ihr zu bringen.
[…] Mit dem Kalender in der Hand,
Herwiedens [?] klugem Mann verwandt,
Kommt in des heißen Sommers Mitten
Festgeber Juli hergeschritten.
Trotz seinem alten, schönen Recht,
Ergings dem Armen aber schlecht.
Er zeigt wohl auf den vollen Mond,
Auf einen hellen Horizont,
Doch ist ein schlimmer, böser Wind
Dem Erndtemann nicht hold gesinnt,
Und unter schatt’gen Irrhains Bäumen
Durft’ von Pegnesia er nur träumen.
So war das Loos, das lieblichste von Allen,
Dem hohen Herrn, Augustus, zugefallen,
Pegnesias-Fest, wo sich in trautem Kreise,
Die Schäfer lagern nach Nomaden Weise,
Wo ein verehrtes Ordensglied,
Für Blumenorden warm erglüht,
Empfängt des Dankes Wort und Gruß
Als Herzens innersten Erguß.
Augustus hatte nichts vergessen,
Nicht Sang, noch Spiel, nicht Tanz, noch Essen,
Und ließ selbst Mond und Sterne funkeln,
Als es begann im Hain zu dunkeln.
Die „Zwanglose Gesellschaft“ zu München nahm den Krieg von 1870/71 zunächst sehr locker. Am 11. November bekam der Blumenorden davon etwas mit: „2.) Derselbige zeigt ein dem Orden geschenktes Exemplar der von dem Ehrenmitgliede p. H. v. Kobell in München verfaßten humorischen Erzählung, betitelt: ,Der Türkn-Hansi, a Gschichtl aus’n Krieg vo’ 1870.’ vor. Euler-Chelpin, der bayerischen Mundart sehr mächtig, theilte es zur allgemeinen Erheiterung mit.“ Schon etwas weniger erheiternd: „4.) […] b.) F. Lösch: Ein Gedicht auf den verstorbenen Felddiakon, Strobel, […]“, aber dann bricht der Siegesjubel aus: „5.) […] c.) Dr. Zahler: Eine Schilderung Napoleon’s III. aus der Zeitschrift ,Die Wespen’.“ und „Geschehen am 23. Xbr. 1870. daselbst. […] 3.) […] a.) Petzet, zwey Gedichte — ,Straßburg’ und ,Victoria’;“
O Straßburg, edles Straßburg, du wunderschöne Stadt,
Die uns der schnöde Franzmann einst frech entrissen hat
Und die im deutschen Reiche wir lange schwer vermißt,
Gott sei gedankt, daß unser du wieder worden bist!
Johannes Heinrich Petzet. So geht es noch 12 Strophen weiter, und abgedruckt ist es im „Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kurier. Nürnberg. Nr. 3. 15. Januar 1871.“ Es ist jedoch nicht so, daß nicht auch edlere Federn zu diesem Anlaß zugeschnitten wurden, konnte man sich zu dieser Zeit ja noch wohl erinnern, daß Straßburg erst im Zuge der Expansionspolitik Ludwigs XIV. durch den Frieden von Rijswijk 1697 an Frankreich gekommen war.
I. Weihelied
Von Emanuel Geibel.
(Melodie: „Gaudeamus igitur“.)
1. Stimmet an den Preisgesang,
Unser Fest zu krönen.
Hell, wie Gottfried’s Harfenklang,
Laßt ihn heut’ ertönen;
Denn die Stund ist hochgeweiht,
Da sich alt’ und neue Zeit
Wundervoll versöhnen!
[…]
4. Gleich dem Münster dort am Strom
Wolkenwärts gewendet,
Steigt ins Blau ihr Riesendom [der in der vorigen Strophe erwähnten „freien Wissenschaft“]
Ewig unvollendet.
Jeder soll willkommen sein,
Der nur einen Quaderstein
Treu zum Werke spendet.
5. Wenn in dumpfem Bann die Welt
Haftet am Erwerbe;
Sind zu Hütern wir bestellt
Für der Menschheit Erbe,
Daß, was geistgeboren ist,
Nicht verkomm’ in dieser Frist,
Noch das Schöne sterbe.
[…]
8. Schlag im Flug dann sonnenan,
Deutscher Geist, die Schwingen!
Nieder Stumpfsinn, Trug und Wahn
Blitzgewaffnet ringe,
Daß in solchem Ritterthum
Dein und Straßburg’s alter Ruhm
Glorreich sich verjünge.
Rudolph Genée schickte aus Berlin, wo er als Theaterhistoriker und Rezitator wirkte, auch etwas an den Blumenorden, von welchem er wohl in der Zeit seiner Herausgeberschaft der Coburger Zeitung etwas erfahren hatte:
Sedan.
Gebrochen ist des frechen Feindes Macht,
Sein Glanz ist ausgelöscht, — in wenig Tagen
Zum Staunen aller Welt ein Heer, ein Volk,
Das übermütigste der Welt, geschlagen! [usw.]
Der Krieg war noch gar nicht beendet, das Neue Reich noch nicht gegründet, da fühlte sich Petzet mächtig veranlaßt zu einem klärenden Wort: „Ein deutsches Wort an die deutschen Katholiken“, erschienen im Unterhaltungsblatt des Fränkischen Kurier. Nürnberg. Nr. 52. 25. Dezember 1870. Es handelt sich um die Aufforderung, eine gemeinsame deutsche Kirche zu errichten. 23 Strophen zu 8 Versen. Daraus:
Schon hat manch bess’rer Mann geredet,
Aus tiefbewegter deutscher Brust
Zu Euch, die Ihr uns einst befehdet,
Weil Ihr nicht besser es gewußt […]
Denn niemals wollte unser Luther,
Der echte treue deutsche Mann,
Daß je die Söhne einer Mutter
Zerklüftete ein fremder Bann.
[…]
Die große Babel ist gefallen,
Zertrümert [sic] der Tiara Pracht;
Von seinen eigenen Vasallen
Ist jetzt zerstört des Papstthums Macht.
[…Das hätt’ ihm so gepaßt. …]
Wir reichen willig Euch die Hände:
Wir glauben All’ an einen Gott
Und beten, daß uns Christus sende
Den Geist, der Alles macht zu Spott,
Was wider Gottes Wort begonnen
Und wider der Vernunft Gebot,
Bis hell und klar das Licht der Sonnen
Uns bringt der Freiheit Morgenroth!
Der Freiheit von dem fremden Zwange,
Der Freiheit von dem schnöden Rom,
Der Freiheit, die im heißen Drange
Gen Himmel strebt im Kölner Dom!
Dort wollen gläubig im Vereine
Wir knüpfen fromm das heil’ge Band
Der freien deutschen Kirchgemeine
Im freien deutschen Vaterland!
Dieser Anlauf zu einem „Deutschen Christentum“ paßt aus späterer Rückschau nicht schlecht zu seinem wahrscheinlichen Antisemitismus.
Gänzlich perfide ist der Mißbrauch seines Amtes zu folgenden Aussagen, die einem islamistischen Haßprediger unserer Tage zuzutrauen wären:
Den deutschen Frauen.
[…]
Wie konnte doch der Franzmann wagen,
Zu reizen uns zum blut’gem Krieg?
Wie konnte er nur Hoffnung tragen
Je zu erwerben einen Sieg?
Ein Volk von Männern und von Frauen,
Von deutschem Muth und Kraft geschwellt,
Nimmt sonder Furcht und sonder Grauen
Den Kampf auf mit der ganzen Welt.
[…]
Denn Eure Seele faßt sich schweigend
In Selbstverleugnung und Geduld:
„Es muß ja sein!“ ruft Ihr erbleichend,
„Und unser Volk trägt keine Schuld.
Es muß ja sein, daß Opfer fallen
In diesem großen, heil’gen Krieg;
Und müssen sterben sie vor Allen,
Ist ihres Todes Frucht der Sieg!“
[…]
Bedächtiger der künftige Präses Wilhelm Beckh einige Wochen später (auch ihm werden beim Beginn des Großen Krieges schrillere Töne entfliehen). „[…] 2.) Nach Beschluß werden in der öffentlichen Versammlung am 6. Februar vortragen:
[…] b.) Dr. W. Beckh, sein in der jüngsten öffentlichen Versammlung nicht zum Vortrag gekommenes Gedicht ,Der deutsche Landwehrmann’, […]“
Zu Chatillon sur Seine in schneeiger Winternacht
Hält an des Jahres Wende ein deutscher Krieger Wacht;
Er schreitet über die Brücke, er wandelt hin und her,
Die Seine zu seinen Füßen rauscht über das eis’ge Wehr.
Er späht hinaus in’s Dunkel und lauscht und zuckt die Brau’n:
Nichts weit im Rund zu hören, nichts ringsumher zu schaun;
Er stampft den Schnee von den Füßen, da schallt’s von den Thürmen her:
Bald Mitternacht! Die Stunde, auf’s Herz fällt sie ihm schwer.
Er denkt der fernen Lieben, denkt an’s entschwundne Jahr,
Wo ihm den ersten Sproßen das treue Weib gebar,
Denkt all’ der tausend Freuden, die er sich ausgemalt,
Wenn an dem heimschen Heerde der deutsche Christbaum strahlt:
„Und jetzt! — Hab’ Acht, mein Auge, entflieh, du Traum der Nacht,
„Hier war’s, wo deutsche Männer man nächtlich ungebracht:
„Die Haus und Heerd verlassen, zu schützen das Heimathland,
„Sie starben auf Frankreichs Erde durch fremder Banditen Hand!
„Wer weiß, ob nicht eine Kugel zu Neujahr mir gratulirt!
„Halt! wer da? Die Parole!“ „Elsaß und Lothringen!“ „Passirt!“
„Gut Nacht, Kamerad, und Prosit bis wir uns wieder seh’n,
„In diesem Jahr wird Keiner von uns mehr Posten steh’n!“ —
Er wandelt wieder einsam, späht in die Seine hinein:
„Elsaß und Lothringen“, sie sagen, wir sollen’s lassen sein,
„Selbst deutsche Federn schreiben von Friede und malen ihn aus;
„Hat keiner von ihnen verlassen sein Weib, sein Kind, sein Haus!
„Hat keiner von ihnen geschlagen siegreich manch’ blut’ge Schlacht,
„Bis endlich die alten Lande zu Deutschland wieder gebracht,
„Die Tausende, die starben, sie fühlten alle gleich:
„Die todten, deutschen Soldaten vermachen das dem Reich!“ —
Da schallt’s von festen Tritten, und durch die dunkle Nacht
Blitzt es wie deutsche Helme, die Runde naht der Wacht;
Und horch! Die letzte Stunde vom alten Jahr tönt her,
Es schultert und präsentiret die Ablösung das Gewehr.
In tiefem Schweigen schreitet die Runde Posten entlang,
Bis endlich im Feldwachstübchen beendet der nächtliche Gang.
Da drängt sich’s an die Gekomm’nen; Prost! ruft’s von fern und nah:
„Wir halten zu Neujahr Weihnacht! Die Liebesgaben sind da!“
„Und weißt du, was sie gehalten so lang, bis heut’ge Nacht?
„Endlose Mengen Geschosse hat vor Paris man gebracht!“
„Dann hab’ ich gern gewartet“, laut es entgegenschallt,
„Mir ist ein Alp genommen, wenns dort auch endlich knallt!“
„Doch komm’ nun, schau die Gaben! Das ist dir zugedacht!
„Die Grüße aus der Heimath halten warm in kalter Nacht!“
“Ach was! da nimm, nach der Wache ist’s doch wohl mehr nach Wunsch
“Ein Glas Feldkessel-gebrauten, feldmäßig erworbenen Punsch!““
„Was mir zumeist, Kam’raden, die Wärme zum Herzen treibt,
„Das ist der Brief vom Weibe, den sie zu den Gaben schreibt!“
Er nimmt ihn vom wollenen Kittel und liest ihn und hebt das Glas:
„Stoßt an, ihr guten Jungen! den deutschen Frauen das!“
Die Jubelrufe klingen hinaus in die kalte Nacht,
Der Wintersturmwind hat sie wohl nach der Heimath gebracht. —
Doch in den Traum von der Heimath und in den Jubel hinein,
Da trifft noch neue Botschaft vom Kommandanten ein;
Sie meldet mit kurzen Worten: Paris wird bombardirt,
Für uns heißt’s mit dem Frühsten auf nach dem Süden marschirt.
Da nimmt der Landwehrkrieger von Neuem das Glas zur Hand:
„Hoch lebe im neuen Jahre das deutsche Vaterland!“
„Wir wagen gern und freudig noch manchen blut’gen Strauß,
„Die Liebe, sie begleitet uns über den Tod hinaus,
„Und Kind und Enkel sagen, wenn uns’rer wird gedacht:
„Er war auch einer von Jenen, die Deutschland groß gemacht!
„Schon hör’ ich die Fanfaren, die Trommel wirbelt heran,
„Wie treten stramm und muthig die deutschen Krieger an!
„Hinaus zu neuem Siege, schon weicht die Mitternacht!
„Gott geb’s! mit dem ersten Frühling ist Friede der Heimath gebracht!
Übrigens ist das die Strophenform des Nibelungenliedes.
Franz Wilhelm Freiherr von Ditfurth, soeben erst aufgenommen, führt sich als Sammler von Volksliedern ein, als der er noch in manchen Wochenversammlungen Beiträge liefern wird; diesmal beleuchtet er die Zeitumstände durch Vergleich mit früheren Kriegen:
„Geschehen am 3. Februar 1871. daselbst.
[…] 2.) […] a.) v. Dithfurt: „Aus seiner Sammlung von 100. historischen Volksliedern des Preußischen Heeres u. zw. ,Schlacht bey Roßbach — Spottlied auf Teplice. Schlacht bey Leuthen — bey Zorndorf — Die Berennung von Breslau, Schlacht bey Torgau — Tod Friedrich des Großen — Schlacht an der Katzbach — Gespräch zwischen Napoleon und Blücher — Gefecht bey Misonde — Schlacht bey Königsgräz’;
b.) Petzet: „Weihnachten 1870. Ein Gedicht im Militairspital;“ — letzterer war um diese Zeit geradezu fieberhaft produktiv.
Angehörige alter Familien und hochgradige Akademiker sehen die Sache eben aus größerer Distanz, sie kennen frühere Siege und Niederlagen bzw. sind schon im voraus ohne Illusionen; beneidenswert die auswärtigen Mitglieder in München:
Bei den Zwanglosen am 12. März 1871
Ihr Herrn jetzt kommt der Champuswein,
Nun mögt Ihr Eure Vivats schrein,
Auf Kaiser und König und’s deutsche Reich
Und was man billig wünscht zugleich,
Freiheit in allem zu jeglicher Zeit
Und Fortschritt bis in die Unendlichkeit,
Ein allmächtiges Heer mit geringen Kosten
Und Flinten und Säbel, die niemals rosten,
Auch daß der Reichstag ja nicht vergesse
Die Erlösung uns’rer geknechteten Presse!
Und ob sich die Toaste noch so bunt reihen,
Der Champus steht hoch über allen Partheien,
Und Aristo-, Demo- und andere Kraten
Wie auch die Homöo- und Allopathen,
Sie waren ja stets ihm zugewandt
Und haben seine Herrschaft erkannt.
Drum frisch heraus mit Sprüchen und Reden,
Der Champus freundlich hilft einem jeden
Und rauscht seinen lieblichen Perlenchor
In festlicher Lust zum Himmel empor!
Kobell.
Vom selben Verfasser eine ernstere Stellungnahme, die erste Reserviertheit gegenüber dem Neuen Reich durchblicken läßt:
Bayern.
Nicht Waffengewalt, nicht Pfaffengewalt
Soll unser Bayern beugen,
Es soll sich seine Fahne nicht
Bevor der Schaft in Trümmer bricht,
Vor diesen Feinden neigen.
Das Schwert begräbt kein edles Recht
Solch’ Thun ist eitle Mühe,
Und wie auch Rom darüber grollt
Und seines Bannes Donner rollt,
Des Geistes Freiheit blühe!
Die Mittel heiligt nicht der Zweck
Und nach Erfolg zu wägen,
Ist nur gemeinen Sinnes Art,
Ist keine Fluth zu guter Fahrt,
Ein Schaffen ohne Segen.
Dem Herrn, der hoch die Sonnen lenkt
Ihm wollen wir vertrauen,
Was unten Macht in dieser Welt,
Ist auf ein Wechselspiel gestellt
Wie Blumenprunk der Auen.
Mag Herrschsucht zieh’n in Flitterglanz,
Er blendet nur die Feigen,
D’rum sei nicht bang mein Vaterland
Vor Waffengewalt und Pfaffentand,
Sie sollen dich nicht beugen.
Kobell.
Karl Euler-Chelpin findet anläßlich des Irrhainfestes von 1871 mit Mühe wieder in friedliche Betrachtungen zurück:
Im Irrgarten am 16ten August 1871.
Wie schnell sich verändert der Mensch u. die Zeit
Das fühlte ich niemals so deutlich wie heut;
Denn — rechne ich richtig? — so sind’s kaum zwey Jahr,
Daß ich als Herr Sauter im Irrgarten war;
Und denke ich heut’ nur um ein Jahr zurück,
So war mir bestimmet von meinem Geschick
Daß ich in dem Kreise der Musen, der neune,
Als Führer derselben — als Apollo erscheine. —
Schon hatt’ ich die Rolle der Gottheit studirt,
Und bin vom Olymp auf die Erde spaziert, —
Auch meine neun Musen die fanden sich ein,
Denn hier im Irrgarten sollt Probe erst seyn. —
Und sieh da! sie ist auch vortrefflich gelungen. —
Doch plötzlich ist uns zu den Ohren gedrungen
Der Kriegestrompete weit schmetternder Ton
Und meine neun Musen — sie liefen davon.
Das Spiel war zu Ende, der Krieg näh’rte sich
Und selbst den Apollo ließ Alles im Stich! —
Nun fleht’ ich Herrn Mars als Collegen recht an,
Und wirklich, er hat auch das Seine gethan.
Er hat unsere deutschen sehr braven Armeen
So reichlich mit Muth und mit Stärke versehen,
Daß sie die mächtigen Feinde geschlagen
Und wir wieder leben in friedlichen Tagen. —
So laßt uns benützen die ruhige Zeit,
Genießen was Geist u. das Herz uns erfreut.
Ihr, liebliche Musen, kehrt nun wieder ein,
Gut werd’t ihr gepfleget in unserm Verein,
Der eifrig bemüht ist, daß ferner erblüh’
Die herrliche deutsche Poesie!
Und da für uns Alles sich gut hat entschieden,
Erschalle ein Hoch! auf Eintracht und Frieden!!
Ohne solche Dezenz schwadroniert der alte Schriftführer Seiler: „Lied im Irrhaine zu singen im Friedensjahre 1871. Nürnberg. Wilh. Tümmel’s Buchdruckerei.
Melodie: Vom hohen Olymp herab etc“
Glück auf! Glück auf! Der Frieden ist erkämpfet!
Darnieder liegt der alte Feind!
Sein Stolz, sein Größenwahnsinn ist gedämpfet!
Das Schwert hat Deutschland nun vereint.
Stimmet drum an den Jubelgesang
Auf Deutschlands Einheit beim Becherklang!
Willkomm! Willkomm! Ihr tapfern deutschen Krieger!
Von Millionen hochgeehrt
Kommt ihr, gekrönt, in allen Schlachten Sieger,
Nach Haus zum heimathlichen Herd.
Stimmet drum an den Jubelgesang
Auf sie, die Sieger, beim Gläserklang!
Heil uns! Heil uns! fort, fort sind die Gefahren,
Die unserm Vaterland gedroht.
Es haben uns geschützt mit ihren Schaaren
Die sie geführt zum Kampf, zum Tod.
Stimmet drum an den Jubelgesang
Auf Deutschlands Feldherrn beim Becherklang.
Ein dreimal Hoch, auf unsre Regenten,
Auf König Ludwig, der voran
Im Süden, rasch den heißen Kampf zu enden,
Sein tapf’res Heer rief auf den Plan.
Stimmet drum an den Jubelgesang
Auf Deutschlands Fürsten beim Gläserklang!
Doch ach! Doch ach! Viel Tapf’re sind geschieden;
Der Gott der Schlachten rief sie ab.
Wir denken ihrer , die nun ruh’n im Frieden,
Im Geiste schmücken wir ihr Grab.
Klagen und wünschen Ruhe hinab,
Und Dank folgt ihnen in’s Heldengrab1
Wohl uns! Wohl uns! singt auch der Blumenorden,
Geschlagen ist der Deutschen Feind!
Zunichte ist sein Satansplan geworden,
Die Welt sieht unser Volk geeint.
Stimmet drum an den Jubelgesang
Auf Deutschlands Großmacht beim Becherklang!
Verluste und gemeinsamer Neuanfang
Johannes Heinrich Petzet ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Mensch, der in politischer Hinsicht völlig unsensibel (im englischen Sinne von „unvernünftig“) ist, dennoch als Gemütsmensch sehr sensitiv (im englischen Sinne von „empfindsam“) sein kann. Und das anläßlich des Verlustes einer Frau, deren Sohn er mit Hurra in den nächsten Krieg hätte ziehen sehen.
Warum mit verhülltem Angesichte
Lehnst du, Muse, über deiner Leier?
Die du sonst, dich sonnend in dem Lichte,
Gerne sangst zu dieses Tages Feier?
Warum nicht in lieblichen Accorden
Tönt dein Lied in Lust und Fröhlichkeit?
warum bist du ernst und still geworden
Gleich der Niobe gebeugt vom Leid?
Wie, du zauderst? Kannst du nicht mehr sprechen?
Schmerzerfüllt nur blickst mich an du lange,
Gleich als ob die Kräfte dir gebrechen,
Zu erleichtern dir das Herz, das bange.
Ach, nun zittr’ ich selber und ich sinke
Dir zu Füßen, schwerer Ahnung voll;
Gieb den Kelch mir, daß ich rasch ihn trinke,
Sag mir, sag mir, was ich hören soll!
Doch umsonst ist all mein Fleh’n und Bitten;
Wie ein Bild von Stein steht ohne Regung
Unter ihren schönen Schwestern mitten,
Tief durchwühlt von schmerzlicher Bewegung,
Unsres Blumenordens holde Muse,
Unsre liebliche Pegnesia,
Gleich als wär’ sie worden zur Meduse
Steht versteint sie und versteinernd da.
Horch! da tönen dumpfe Glockenklänge,
Durch die Lüfte zieht ein leises Klagen,
Und, umgeben von des Volks Gedränge,
Wird zum stillen Friedhof hingetragen,
Reich geschmückt mit Blumen und mit Kränzen
Trotz dem schaurigkalten Wintertag,
Der die Tränen läßt als Perlen glänzen, —
Ein verhüllter, schwarzer Sarkophag.
Und die Muse öffnet nun die Lippen
Und ergreift mich weinend bei den Händen:
„Sieh, die Tochter hold von Aganippen
Also muß sie ihren Lauf vollenden!
In die Erde sinkt die schöne Leiche,
Die selbst todt noch liegt mildlächelnd da!
Fragst du noch, warum das Haupt ich neige?
Wer gibt mir zurück Valeria?
Keine hat wie sie so treu und willig
Manches Jahr gedient mir unverdrossen
Von Euch Allen, darum traur’ ich billig,
Daß ihr helles Auge sich geschlossen.
Und fürwahr, Ihr dürft die Häupter senken
Trauervoll und thränenschwer mit mir,
Bleibt unsterblich auch ihr Angedenken,
Ach, am meisten habt verloren Ihr!
Wer giebt Euch sie wieder? … Wenn am Abend
Nach des Tags beschwerlichen Geschäften
Ihr Erholung suchtet, wer hat labend
Euch erquickt mit neuen Lebenskräften?
Wer hat aus des Alltagslebens Staube
Euch so oft emporgetragen mild?
War’s nicht an das Göttliche der Glaube,
Den verklärt Euch stellte dar Ihr Bild?
Traum des Lebens, Liebling der Gedanken,
Blumenkelch in jedem Menschenherzen,
Immergrün mit ewig frischen Ranken,
Klarer Quell, an dem die Lämmer scherzen,
Kompaß bei der Fahrt an Klippenborden,
Abendstern mit sanftem milden Schein, —
Das war Ihr die Poesie geworden
Und das sollte auch für Euch sie sein.
Wenn ihr Mund, den stets die Charitinnen
Hold umflatterten mit süßen Scherzen;
Wenn ihr Mund verkündet, was tiefinnen
Sie gefühlt im lebenswarmen Herzen:
Sag’, wer fühlte sich nicht aufgerüttelt
Aus der Schwermuth, die ihn tief gebeugt?
Wer hat da nicht fröhlich abgeschüttelt
Allen Gram, blieb auch das Auge feucht?
Ihre Lieder, ach wie warm und sinnig
Priesen sie des Lebens höchste Güter!
Ihre Worte, ach wie weich und innig
Senkten sie sich ein in die Gemüther!
Ihre Blicke, ach wie Sonnenstralen
Drangen sie erwärmend in das Herz,
Scheuchend weg des Erdenlebens Qualen
Und erhebend mächtig himmelwärts!
Und das Alles, ach es ist entschwunden,
Nimmer klingt die holde Stimme wieder!
Nimmer singt sie warm und tiefempfunden
Euch die zarten, zauberduft’gen Lieder!
Von des Gatten und des Sohnes Seite
Riß sie weg der Tod in finst’re Nacht,
Der in tiefen Gram versenkt sie beide
Und auch Euch das schwerste Leid gebracht!“ —
So die Muse. Und mit thränenschweren
Blicken sah ich ihren Sarg versinken.
Doch bald sollten sie sich neu verklären,
Denn ein Kreuz sah über’m Grab ich blinken.
Nicht das Kreuz vom König und vom Kaiser,
Das mit Recht auch Ihre Brust geschmückt,
Während wohlverdiente Lorbeerreiser
Ihr das Vaterland auf’s Haupt gedrückt:
Nicht dies Kreuz, — ein bess’res sah ich prangen,
Jenes Kreuz, an dem voll Angst und Beben
Unser Heiland selber einst gehangen,
Zu erwerben uns das ew’ge Leben.
Und am Kreuz, da stund in gold’nen Lettern
Hell ein Spruch vom ew’gen Lebenswort:
Mag der Tod die Blume hier entblättern,
Unvergänglich blüht und prangt sie dort!
Nein, sie ist nicht todt! Des Körpers Hülle
Sank allein hinab zum Schoos der Erde.
Doch auch ihr zu neuer Lebensfülle
Ruft dereinst des Schöpfers mächtig Werde.
Und der Geist, der diesen Leib belebte,
Ist erstorben nicht, er ist nicht todt,
Er, der aufwärts stets zum Himmel strebte,
Ist im Himmel, ist daheim bei Gott! — —
Muse, du bist selbst nur eine Dichtung,
Nur ein Bild von unsern Idealen:
Deine Hülle kann die strenge Sichtung
Nicht besteh’n; der Wahrheit Sonnenstralen
Machen Dich vergeh’n! Doch uns’re Todten,
Die im HErren sterben, wie er sprach,
Sie sind selig und als Liebesboten
Folgen ihre guten Werke nach!
Auch im Literarischen Verein war eine impulsgebende Dame, allerdings zusammen mit ihrem Ehemann, dem Tode anheimgefallen: Luise Hoffmann und der erste Vorstand, Johann Leonhard Hoffmann, waren 1865 von einer Spanienreise nicht zurückgekehrt, und es stellte sich dann heraus, daß sie in Albacete an der Cholera gestorben waren. Zusammen mit einer Liberalisierung des Vereinsrechts in Bayern, welche die Festivitäten des Vereins um ihre Einzigartigkeit in Nürnberg brachte, führte das zu einem merklichen Abschwung, dem sich eine zeitlang noch der Vorstand Friedrich Knapp entgegenstellte.
„Der Reimchronik fünfundfünfzigstes Stück.
Am 15. November 1872.“
5576. Vernünftig ist’s und löblich stets, zur rechten Zeit bedacht zu sein
Daß nicht der Haushalt leide Noth, in allem auf der Wacht zu sein
Daß jedes Ding am rechten Ort und brauchbar zu der rechten Zeit
Daß kein’s den And’ren hinderlich beim Machtwort der Nothwendigkeit.
5580. Und löblich ist’s am Jahresschluß zu überschaun das ganze Haus,
Zu prüfen seine Tüchtigkeit und was ihm fehlt, zu bessern aus —
Die Mittel dann zu Rath zu ziehn, mit denen man zu rechnen hat —
Daß mit dem Soll das Haben stimmt und alles reinlich sei und glatt.
Wohl herrscht der Schwindel alleweg im Haus und Kirche und Geschäft;
Wer darauf gläubig Häuser baut, der findet schließlich sich geäfft
Und klagt den bösen Schwindel an, der einer starken Ceder glich
Doch bei dem kleinsten Wechselfall sich auswies als Spitzederlich
Der böse Schwindel thut es nicht, Du selbst hast Augen, Mund und Ohr,
Vernunft, Erfahrung, Muth und Kraft und, macht Dir Einer Schwindel vor,
5590. So prüfe, wähle und verwirf, damit vor Schaden heil Du bleibst,
Vor allem aber hüte Dich, daß Du nicht selber Schwindel treibst.
———————
Da — unsern Literarischen! da nehmt Euch ein Exempel d’ran,
Der hält zur rechten Stunde inn’ und handelt als ein Ehrenmann,
Gesegnet war die Kindheit ihm, viel wack’re Pathen zählte er
Und unter braven Vätern, seht! die allerbrävsten wählte er
Der Eine stattete ihn aus, hielt ihn an Kleid und Börse warm,
Der And’re stärkte seinen Geist und führte ihn mit starkem Arm.
So ausstaffirt wuchs er heran, trat bald die Kinderschuhe aus
Noch jung an Jahren sah er sich in einem wohlverseh’nen Haus,
5600. Litt niemals Mangel, selten Noth, er lebte ja in treuer Hut;
Was er auch anfing. glückte ihm, was er begann, gerieth ihm gut.
So schritt er den Gesellen vor, ein Vorbild wurde Allen er
Rings drängten Freund an Freunde sich, bei Allen fand Gefallen er —
Es galt sein Wort, sein Beispiel zog und was er sprach, war gern geglaubt,
Sein Haushalt wuchs, da dieß und mehr ihm seine Mittel ja erlaubt.
Da kam die Zeit, da drängten sich auch Nebenbuhler kühn heran,
Sie lockten seiner Freund Schwarm, indem sie’s ihm zuvor gethan,
Mit wonnesüßem Saitenspiel, mit Scherz und Tanz sie es versucht —
Und bald mit Ueberbieten nur verhindert er die Fahnenflucht:
5610. Ball, Festmahl, Kränzchen, Maskenspiel, im Sommer Ausflug mit Musik,
So feßelte die Treuen er und hielt die Flüchtlinge zurück.
Da kam die Zeit! er war verwaist, die Väter Beide er verlor
Und eine treue Vormundschaft in dunkler Stunde er erkor —
Noch hielten seine Mittel aus, doch nahte manch Bedenkliches
So Manche ahnten, daß vorbei die Tage von Arnajuez.
Ja viel ließen ihn im Stich, die besten Kräfte mieden ihn,
Die einst reich tafelten mit ihm, mit magrer Kost beschieden ihn
Und wenn auch Spiel und Tanz gelockt, stets leerer, dürft’ger ward sein Haus
Und eine Frage wars der Zeit, wann ihm die Mittel gingen aus:
5620. Ward auch das Möglichste erdacht, nur Wenige hielten treu und fest
Sie hielten Rath, befeuerten und überzählten trüb den Rest.
Nun kam die Zeit! Gesegnet sei die Stunde, Heil sei dem Entschluß!
Da hielt er redlich Umschau, wie sie ein jeder Braver halten muß,
Er sprach: Wenn ichs bedenke recht, was frommt mir ein erborgter Glanz,
Der mir doch keine Freunde kirrt — zum Guckuck mit dem Firlefanz! —
Was nützt mir ein verwaister Saal, was nützt des armen Vorstands Qual
Der für Vereinssaharas aus den Stoppeln sucht Material,
Der rastlos die Activen preßt, der selbst wie noch ein Neger schanzt
Nur, daß ein künftiges Programm nicht gar zu dürftig sei bepflanzt,
5630. Was nützt mir Ball und Maskenspiel, wenn theilnahmslos so viele sind,
Wenn meine Muse noch so zaubrisch Mährchengold vom Rocken spinnt!
Wir haben, was es nützt, geseh’n; der biedre Säckelmeister spricht:
Noch weiter, wie bisher zu gehn, da reichen unsre Mittel nicht.
Die Mitarbeiter, sonst so flink, sie fehlen uns zu jeder Frist
Der Vorstand klagt, mit Fug und Recht, drob jammert auch der Reimchronist —
Drum fegt von dem kostspiel’gen Quark nur Diehle, Haus und Schwelle rein,
Laßt uns mit weniger halten Haus, doch damit ganz zufrieden sein.
Gesagt, gethan, es bleibt dabei; daß er sich nach der Decke streckt
Ist ehrlich, gut und wohlgethan, ob es gar Viele auch geschreckt,
5640. Ob auch so Mancher sagt Valet, bleibt nur der ächte Freund uns treu
Und hält den wahren Zweck im Aug — das Andre sei uns einerlei.
Schließt nun die Runde enger sich, verklingt auch mählig Tanz und Spiel,
Mag um so freud’ger werben uns’re kleine Schaar um’s schöne Ziel.
Vielleicht schließt sich Mancher sich an uns und bietet warm uns seine Hand,
Der ob des Beiwerks Vielerlei bisher der Runde ferner stand,
So senken zum krystall’nen Born des deutschen Worts in Sinn und Lied
Erfrischend wir die heiße Stirn vom staub’gen Tagwerk noch durchglüht,
Erquicken Auge, Geist und Herz, ermattet in der Zeiten Drang
Und lauschen den gewaltigen verklärten Meistern im Gesang,
5650. Erschauen, was des Tages Muse uns auf flücht’ge Blätter streut
Und laben an der Quellfluth uns verständiger Geselligkeit.
Vielleicht naht wieder eine Zeit und frischen Sinns wir treten aus
Dem engen Kreis gekräftigt in das neue festlich schöne Haus
Und zünden neu die Leuchte an, die uns zu Tanz und Spielen winkt
Und junger Recken blüh’ndem Wort aus schönen Augen Beifall blinkt —
Vielleicht! — Jedoch bis es so wird (und werde uns’re Hoffnung wahr!)
Bleibt der bescheid’nern Runde treu! Dieß wünscht das Reimchronistenpaar.
Ein gewaltig umfangreicher und mit seltenen Ausdrücken gespickter Wortschatz zusammen mit Beobachtungen und Kenntnissen sehr konkreter Art aus den verschiedensten Gebieten stand Knapp zur Verfügung, eine leichte Hand beim Versifizieren, die über gewisse Schludrigkeiten großzügig hinwegging, zumal diese Arbeiten aus dem Tagesbedarf hervorgingen und wöchentlich vermehrt wurden. Die Versezählung verrät, daß er dennoch stolz war auf seine Fruchtbarkeit und durchaus an die Bewunderung der Nachwelt dachte, aber er war klug genug, keine Sammlung an das allgemeine Publikum gelangen lassen zu wollen. Verwirrend ist, von mehreren Reimchronisten zu lesen, doch war es eine Ausdifferenzierung verschiedener Züge seiner Persönlichkeit wie bei Robert Schumanns Florestan und Eusebius.
Auch im Blumenorden nimmt zu dieser Zeit die Zahl der Anwesenden bei den nichtöffentlichen Versammlungen ab. Am rührigsten ist in dieser Periode v. Ditfurth, der fast jedesmal entweder aus seinen Volksliedersammlungen vorträgt oder auch eigene Gedichte verliest. Die Vereinigung mit dem Literarischen Verein bringt dann ein Aufleben der Beiträge und der Stimmung, an dem auch Knapp mit manchem Humoristischen tätig Anteil hat:
Elegie auf einen Igel
1. Betrübten Sinnes laß ich gleiten
Die Finger über dumpfe Saiten
Mit Flor will ich mein Spiel verhüllen
Um ernste Pflichten zu erfüllen
Man glaube, daß frivolem Zwecke
Ich nie die Hand entgegenstrecke
Und dießmal gilts auf Sangesflügel
Dem tödtlich hingeschiednen Igel.
2. In meiner Handelsmühle hatten
Sich eingenistet viele Ratten,
Auch horsteten mit regem Fleiße
Im Magazin emsige Mäuse,
Die um gar schnöden Zweck’s Erreichung
Zum Mehltrog faßten stille Neigung:
Als unbestechlich festen Riegel
Schob ihnen ich davor den Igel.
3. Er war nicht lieblich von Gestaltung,
Jung’s Antlitz in antiker Faltung
Um seiner Glieder edler Bauart
Sah man ein Kleid, das stets mehr rauh ward,
Als trutzge Rüstung sah man blitzen
Stahlharte scharfgeschliffene Spitzen
So hielt die Mauswelt er im Zügel
Der nie genug geschätzte Igel.
4. Ich spendete aus deutschem Haine
Hans Bartel Most, genannt der Kleine
Ein Wagenwärter 4ter Classe
Zum Besten seiner mageren Casse —
Wie er ihn fing, ob mit Verstellung,
Ob mit hagbüch’ner starker Prellung
Ob in dem Bau, ob auf dem Hügel —
Genug! Mein ward der tapf’re Igel.
5. So lebt er friedlich dem Berufe
In eines kleinen Sackes Kufe,
Er füllt mit penetrantem Dufte
Der gierigen Nager Unterschlufte,
So daß, wie Mecklenburg u. Hessen
Sie auszuwandern sich vermessen —
Indessen schlürft aus irdnem Tiegel
Verdiente Milch der gute Igel.
6. Augustus gleich, doch ohne Tunke
Von Essig, liebt er Kohl vom Strunke,
Auch Blaukraut, Selerie und Wirsig
Die hatten etwas bei ihm für sich,
Auch wußte er sich gut zu nähren
Mit Grundbirn oder Scorzoneren [Schwarzwurzeln] —
Verschwiegen war er wie ein Siegel —
Genug! Er war kein Schweine-Igel.
7. Hunds-Igel rühmt er seine Sippe,
Man sah’s der schnurrbartreichen Lippe
Man sah’s den Zähnen an, den spitzen
Und seines Augs muthvollem Blitzen.
Er jagte, wie ein Abdelkader
Mit dem bewährten Hinterlader
Die Ratten selbst durch Mauerziegel
Der damals, ach! so munt’re Igel.
8. So lebt er in taktvoller Haltung
Ihm anvertrauter Jagdverwaltung
Beging getreulich die Reviere
Ob er von Glis und Mus was spüre
Und sichtlich ohne Übertreibung,
Die Sackaufmaßungsunterbleibung
Ward zum „polirten Ehrenspiegel“
Dem tugendreichen strammen Igel.
9. Es war ein Tag notabel trocken
Da sah man auf der Matte hocken
Ihn todt, sein delikater Magen
Mocht wohl den Mehlstaub nicht ertragen
Ob’s waren indische Gestianen
Ob’s waren optische Strunklianen
Kurz, er verlor des Lebens Zügel
Und starb, wie er gelebt, als Igel.
10. Nicht unbeklagt, nicht unbeneidet,
In starrer Pflicht Gewand gekleidet
Treu, wie der Treueste der Treuen
Achtsam — nichts konnte ihn zerstreuen
Wahr — keine noch so kleine Lüge
Glitt über die caton’schen Züge
Verläßlich wie ein ficht’ner Prügel,
Ging er ins Land verklärter Igel.
11. Wer wird an seiner Stelle schalten,
Die Mausvertreibungskunst verwalten,
Wer mit markirtem Hochparfüme
Die Ratten jagen nach Maxime?
An solches laßt mich Morgen denken
Heut’ meiner Trauer Weisen senken
Auf den erkauften Maulwurfshügel
Der schützend birgt den guten Igel.
Wartburg [Gasthaus Zur Wartburg] 2. Oct. 1874
FrKnapp
Ein weiterer Neuzugang im Orden, der aus München zugezogene und 1881 aufgenommene königliche Postspezialkassier August Schmidt, machte mit seinen volkstümlichen Theaterstücken bekannt, z.B. „Süd und Nord oder Verlorene Schmerzen. Komisches Charakterbild aus dem bayerischen Oberlande mit Gesang in 1 Akt von August Schmidt. Musik vom k. Kapellmeister Jul. Lang in München. Bühnenmanuscript. Zum ersten Male im Juni 1874 am kgl. Theater am Gärtnerplatze zu München mit vielem Beifalle aufgeführt. München, 1874. Kgl. Hof- und Universitätsdruckerei von Dr. Wolf & Sohn in München.“
Es handelt sich um eine Farce, in der ein Bayer mit einem Preußen rauft, dieser eine Geldsumme begleichen muß, die nun dem Bayern erlaubt, um die Hand seiner Liebsten anzuhalten. Damit ist in anbetracht des gemeinsamen Sieges von 1871 der Bruderkrieg von 1866 folkloristisch verarbeitet.